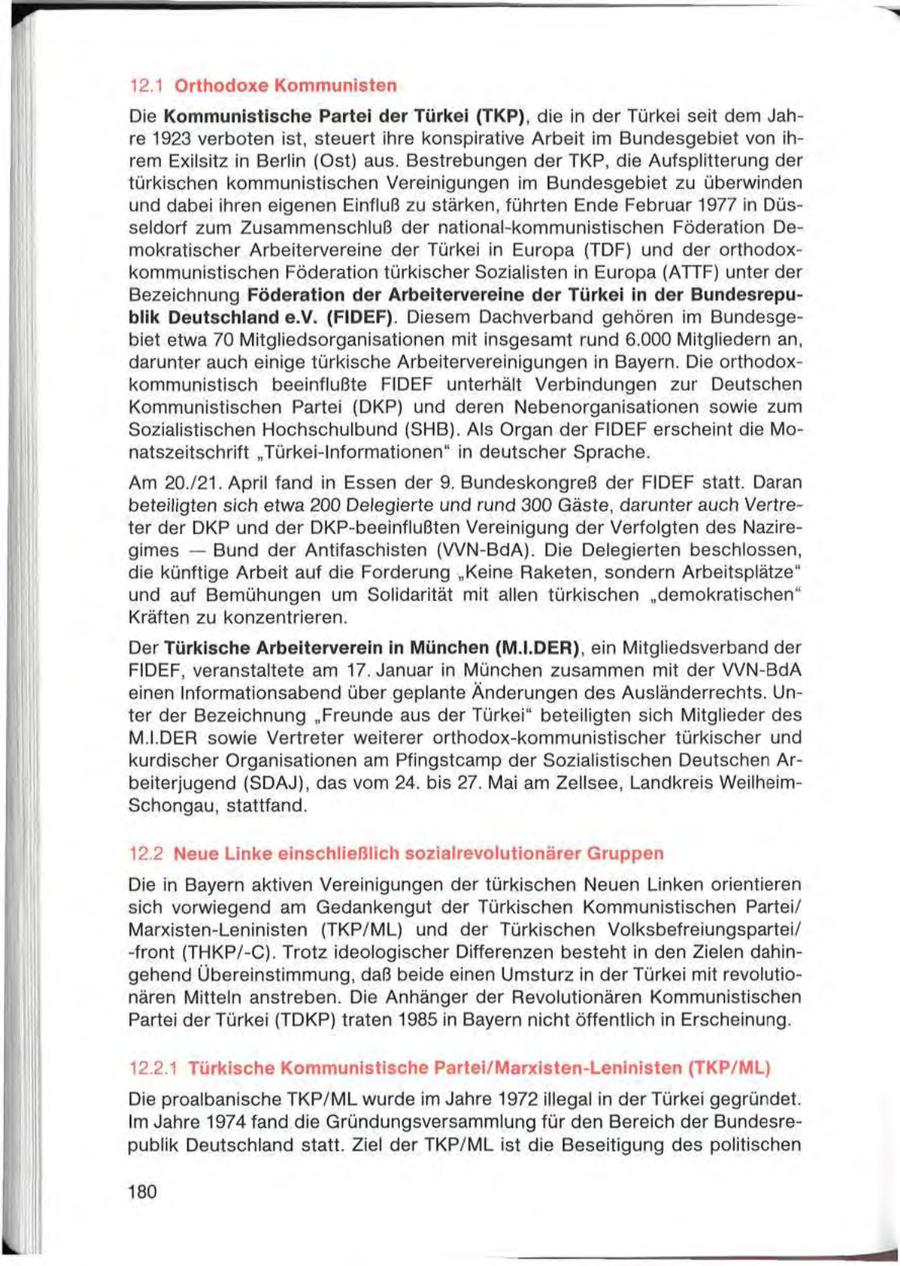Verfassungsschutz Suche
Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.
Treffer auf 10776 Seiten
"kommunistische partei" in den
Verfassungsschutz Trends
- Blick auf den nächsten Parteitag, zu erreichen, daß in den meisten dieser Konzernund Großbetriebe wirkungsvolle kommunistische Arbeit geleistet wird
- dieser Betriebsarbeit sind vorrangig die Betriebsgruppen, die nach dem Parteistatut wichtigsten Grundorganisationen der Partei. Die wesentliche Aufgabe dieser Betriebsgruppen besteht
- Vorsitzenden Mies auf der 5. Tagung des Parteivorstands: "Für die zukünftige Entwicklung der Bundesrepublik, für den Ausgang der Auseinandersetzungen
- Betrieben, in denen die DKP noch keine "praktische kommunistische Arbeit" leisten konnte, sollen Betriebsaktivs geschaffen werden, deren erklärtes "Kampfziel
- einem UZ-Artikel berichtete ein Mitglied des DKP-Parteivorstandes u.a. über seine Arbeit mit "Betriebsaktivs". Obwohl sein "eigenes Betriebsaktiv" für
- geschaffen, eine "betriebliche Friedensinitiative" aufgebaut und eine "Arbeitsgemeinschaft aus Kommunisten und Sozialdemokraten" gebildet worden. Auch das "Klima im Betriebsrat
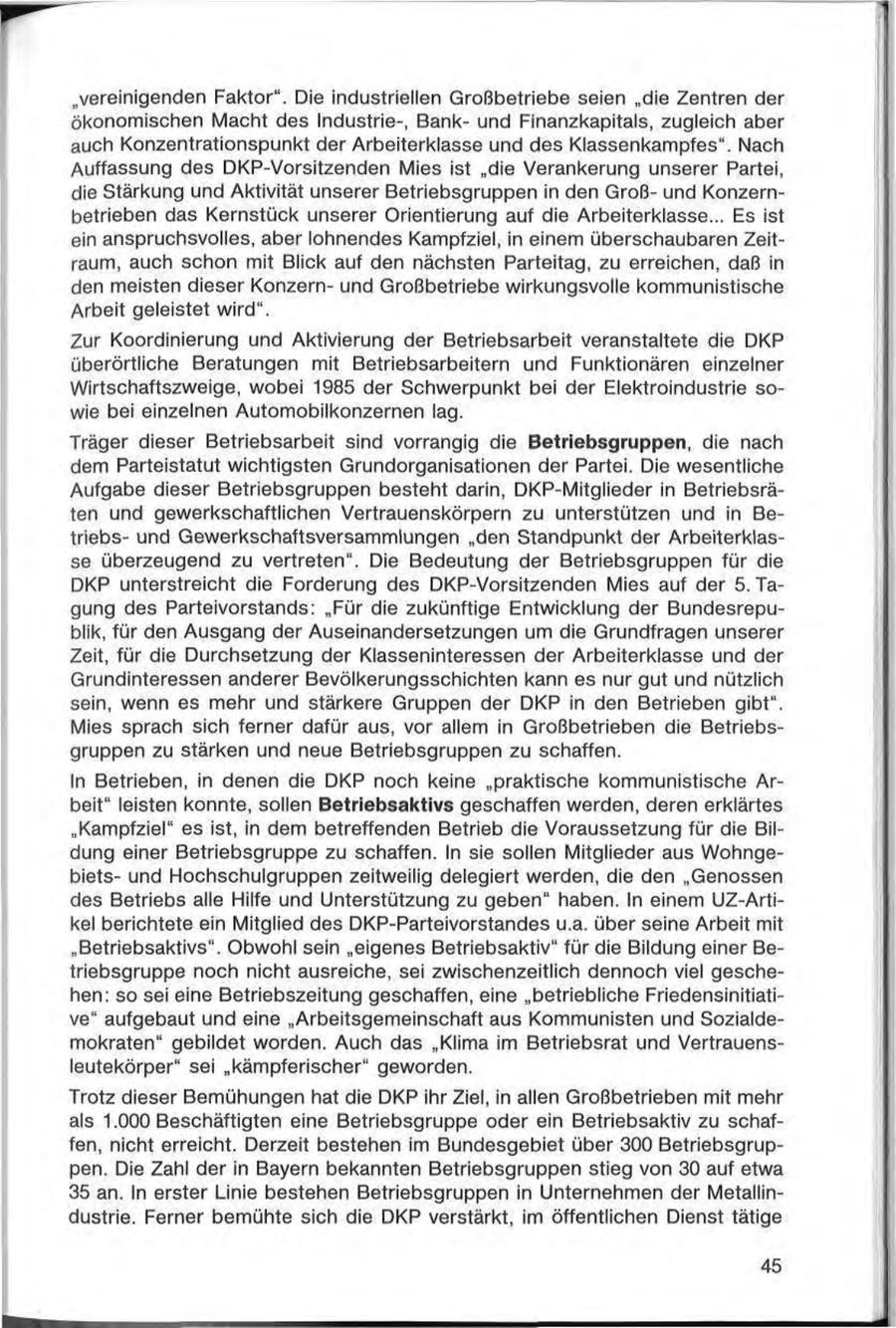
- auch für unser Land der Sozialismus" notwendig. Da für Kommunisten Mitbestimmung "kein Instrument der Partnerschaft zwischen Kapital und Arbeit
- Aktionseinheitsund Bündnispolitik" des Entwurfs der "Thesen zum 8. Parteitag der DKP" hingewiesen: "Die betrieblichen Friedensinitiativen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen
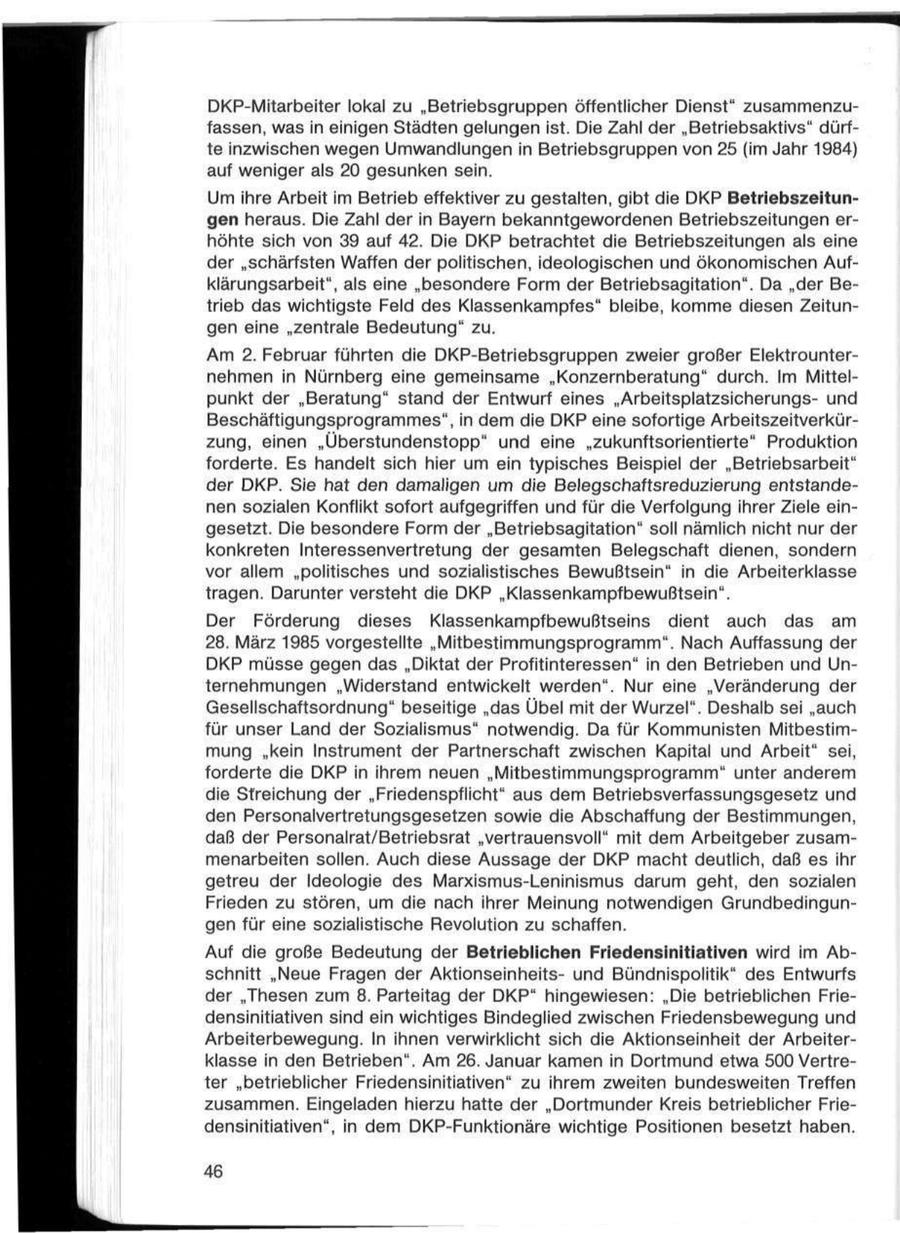
- Darüber hinaus habe er Kontakte zu entsprechenden Gremien anderer Parteien und der Gewerkschaften zu knüpfen. Aus dieser Äußerung geht klar
- kommunistischen Presse "Lehrer, Pädagogen und Elternvertreter" teilnahmen. Auf dem Kongreß forderte der Referent für Schulund Bildungspolitik beim DKP-Parteivorstand eine
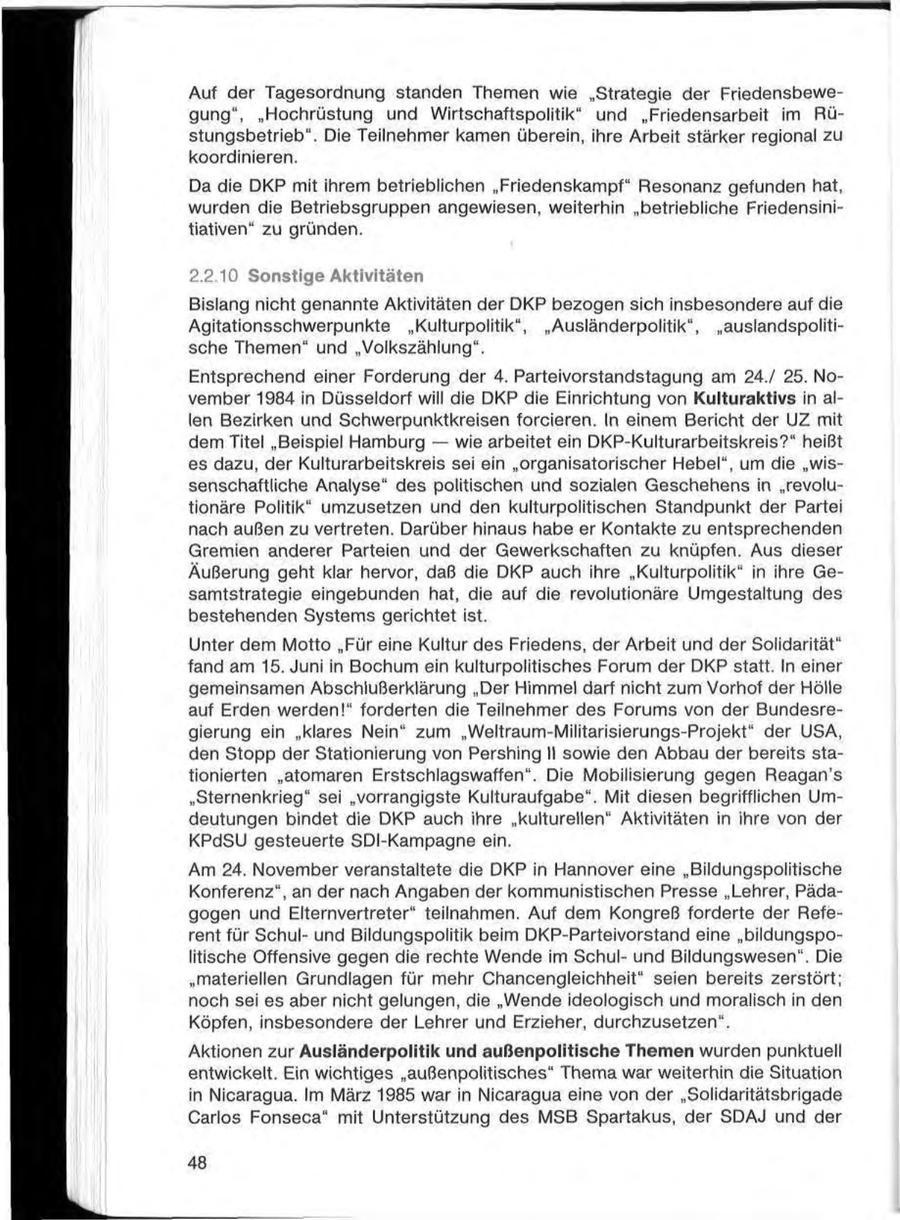
- African Peoples Organisation" (SWAPO) und der internationalen Abteilung des Parteivorstandes der DKP. Der DKP geht es mit ihrem "Südafrika-Engagement
- Verstöße nur zu rügen pflegt, wenn sie außerhalb des kommunistischen Machtbereichs stattfinden. Vielmehr fügt sie sich auch mit dieser Kampagne
- ausländischer Arbeiter in der Bundesrepublik zuständige Referent beim DKP-Parteivorstand kritisierte im März 1985 in einem Bericht unter dem Titel
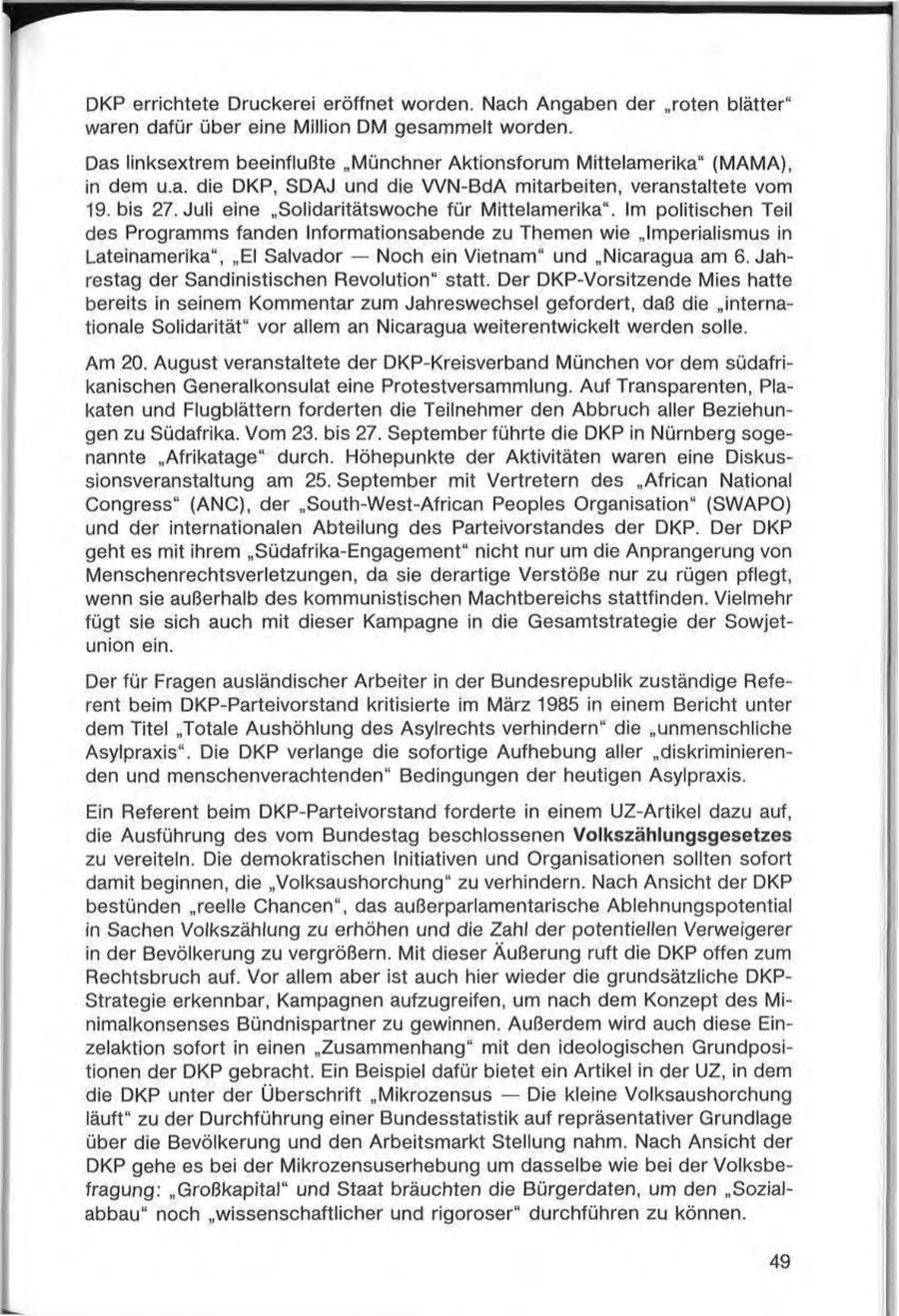
- betrug 1985 bundesweit rund 4.000. Nach Angaben der kommunistischen Presse bestanden zu Beginn des Jahres 1985 im Bundesgebiet
- Mitglieder. Zu den Gästen zählten der DKP-Parteivorsitzende Mies, die Bundesvorsitzende der SDAJ Birgit Radow, Vertreter von 15 anderen Kinderbzw
- Auch die übrigen 5 Mitglieder des Bundessekretariats sind orthodoxe Kommunisten. Am 13. Januar fand in München die Landeskonferenz
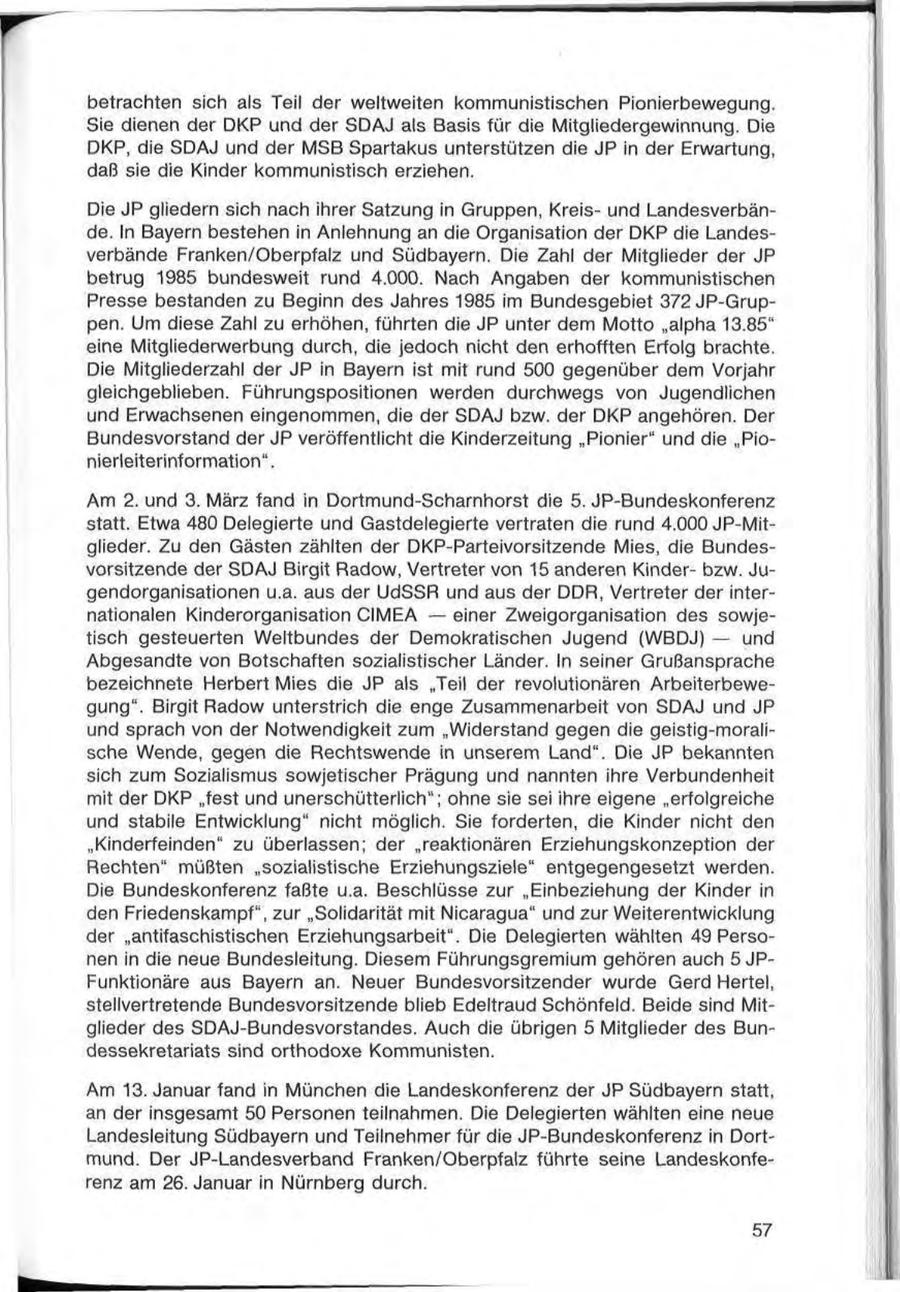
- werden, die nicht Teil der Partei oder ihrer Nebenorganisationen sind, aber gleichwohl dazu dienen, kommunistische Zielsetzungen zu fördern. Außerdem bemüht
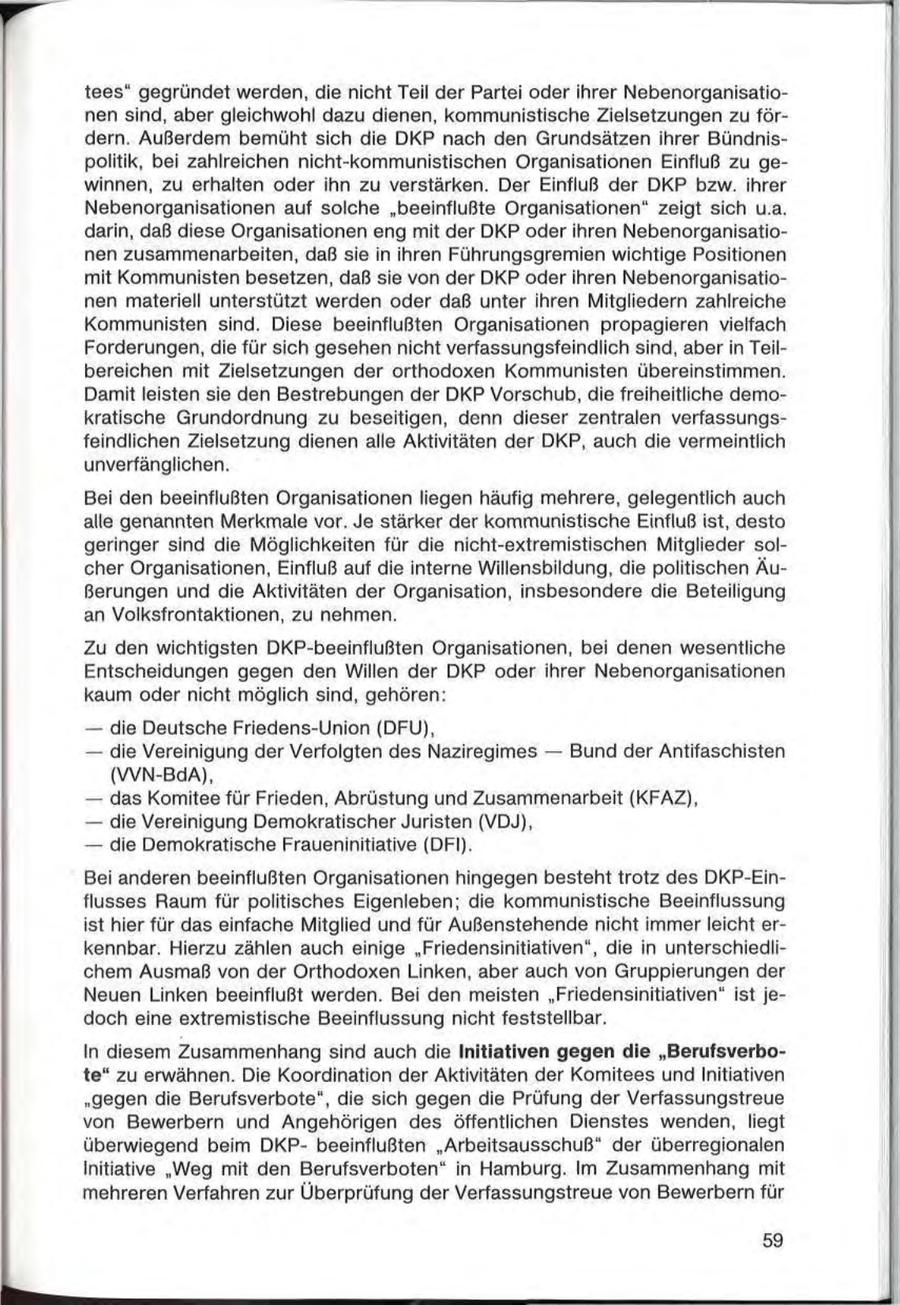
- Deutsche Friedens-Union (DFU) Die DFU wurde 1960 auf kommunistisches Betreiben als "Volksfrontpartei" gegründet und ist Mitglied des sowjetisch gelenkten
- Bündnis mit der Arbeiterbewegung, mit ihren Gewerkschaften und Parteien möglich ist". Verfassungskonforme Forderungen, die auch von demokratischen Kräften vertreten werden
- beeinflußter Organisationen in verschleierter Form mit Zielsetzungen der orthodoxen Kommunisten verbunden. Die politische Betätigung der DFU dient in erheblichem Umfang
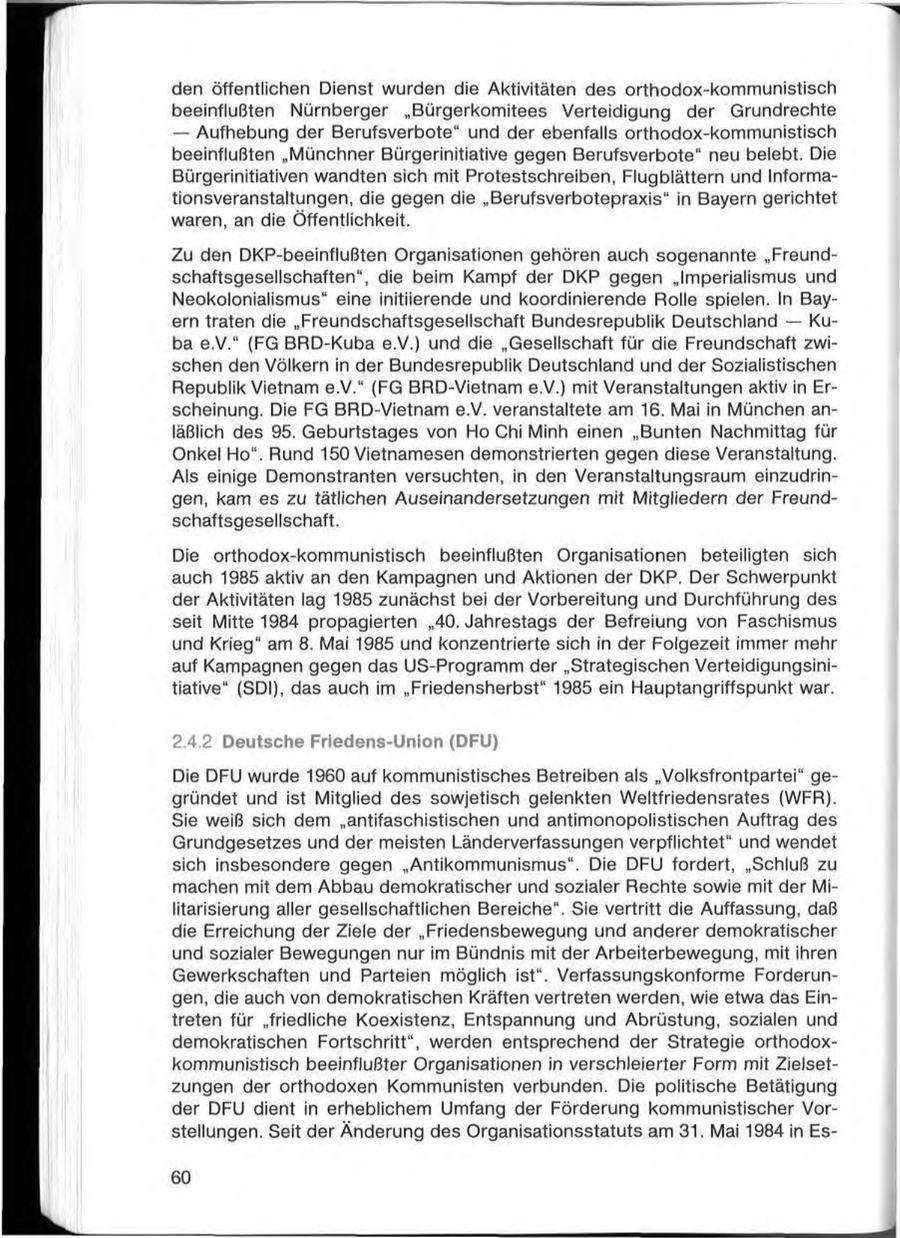
- versteht sich die DFU nicht mehr als Partei, sondern als "politische Vereinigung". Auf Bundesebene wird die DFU vom Bundesvorstand geleitet
- verbotenen KPD an oder sind Mitglieder einer kommunistisch beeinflußten Organisation. Die DFU verfügt über neun Landesverbände, die weiter untergliedert sind
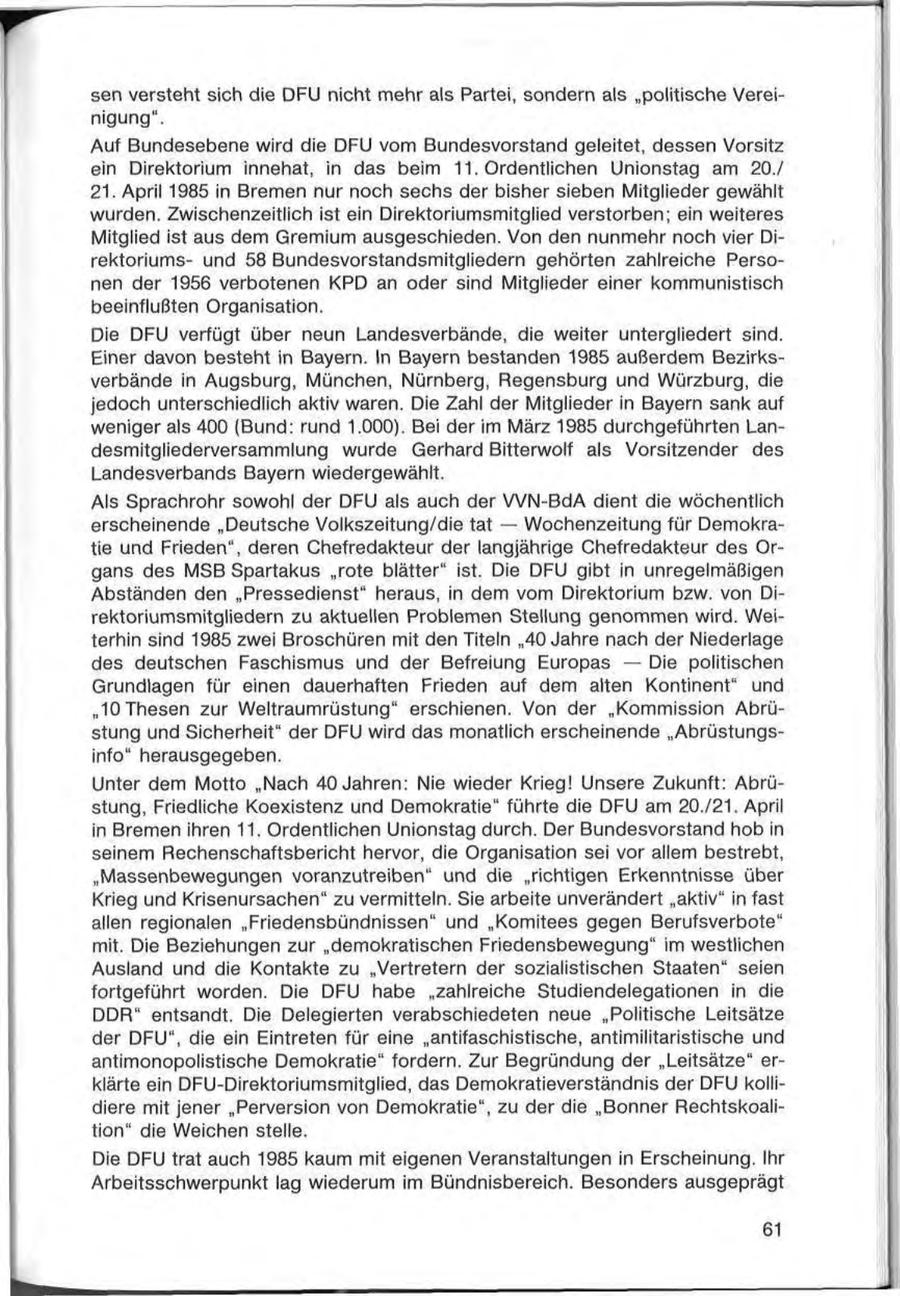
- könnten und müßten sich "Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen und Anhänger anderer Religionen, Liberale, Grüne und Parteilose zusammenfinden". Durch eine breit angelegte
- Büromitglied des DKPbeeinflußten KFAZ. Generalsekretär ist das DKP-Parteivorstandsmitglied Kurt Erlebach. Vorsitzender des Landesverbandes Bayern
- Mehrzahl sind die 86 Mitglieder des Präsidiums Kommunisten. Sprachrohr der WN-BdA ist die Wochenzeitung "Deutsche Volkszeitung/die tat -- Wochenzeitung für
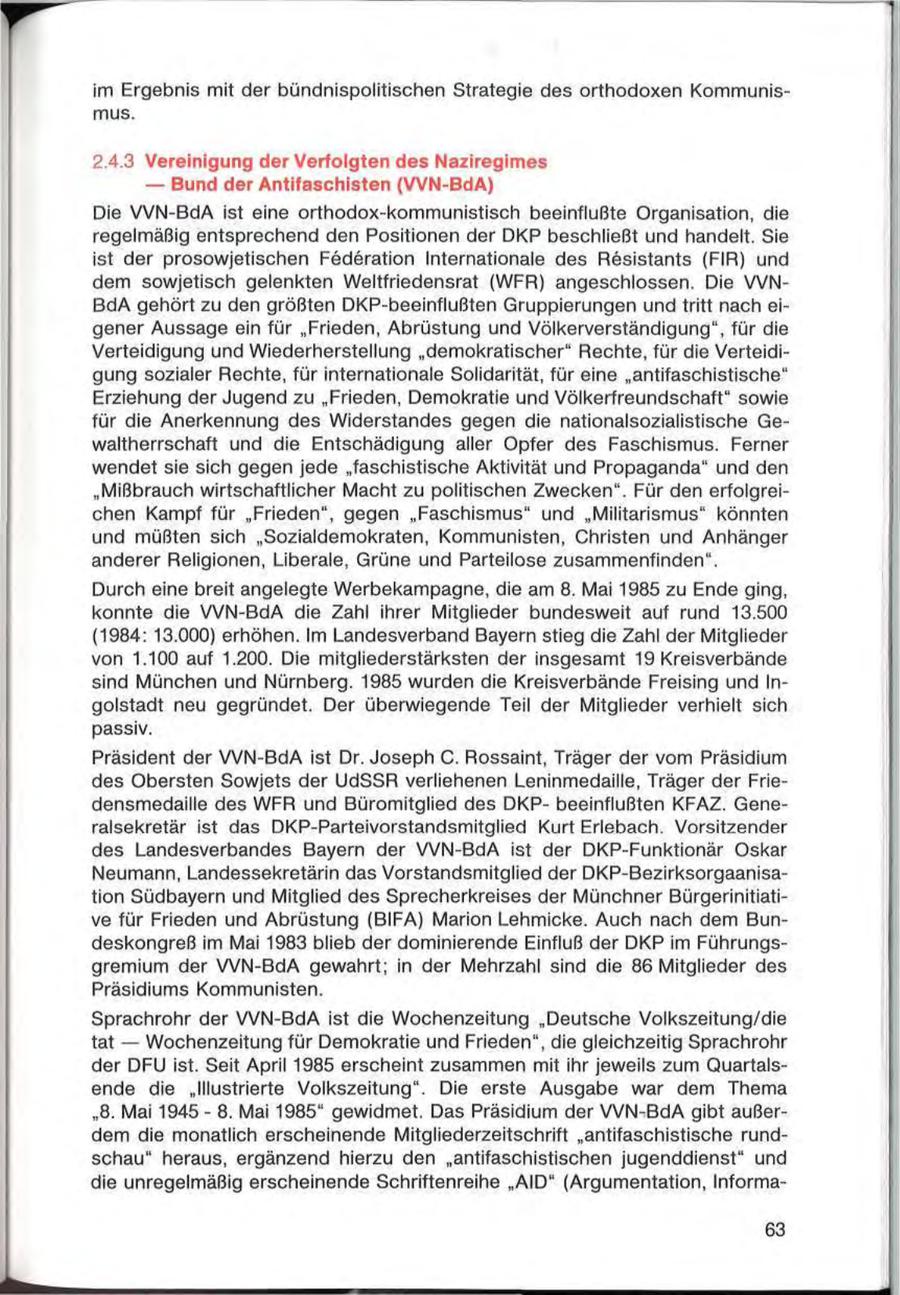
- Landshut am 19. Januar, gegen die NPD-Parteitage am 13. April in Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
- Argumentationslinie zeigt, daß auch die WN-BdA entsprechend orthodox-kommunistischer Taktik jedes Thema zum Anlaß nimmt, einen "Zusammenhang" mit ihren
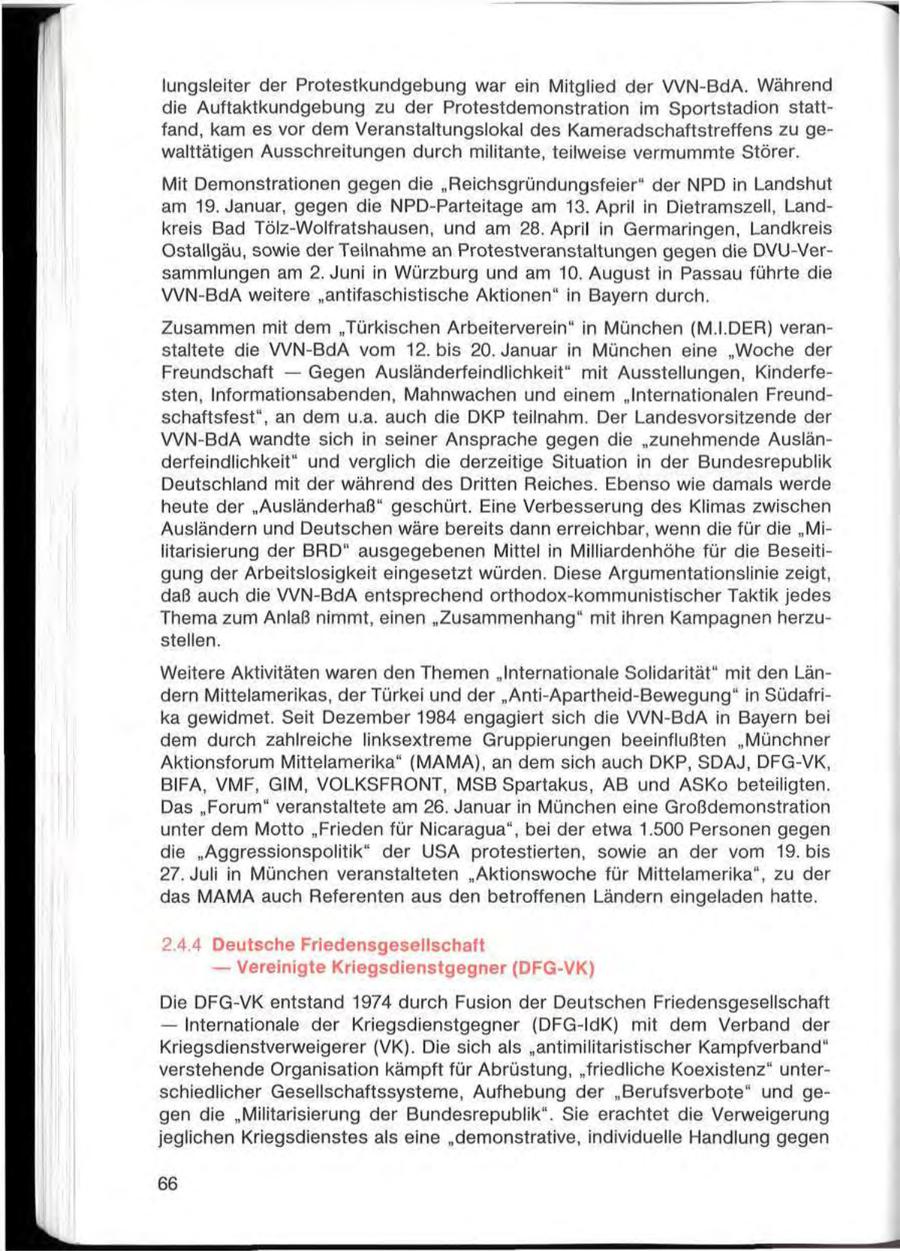
- aber auch die mit dem höchsten Anteil an nicht-kommunistischen Mitgliedern. Gleichwohl hat sie seit etwa drei Jahren Mitgliederverluste
- einen neuen Bundesvorstand und beschlossen Änderungen der Satzung. Der Parteivorstand der DKP übersandte ein Grußschreiben und war durch einen Mitarbeiter
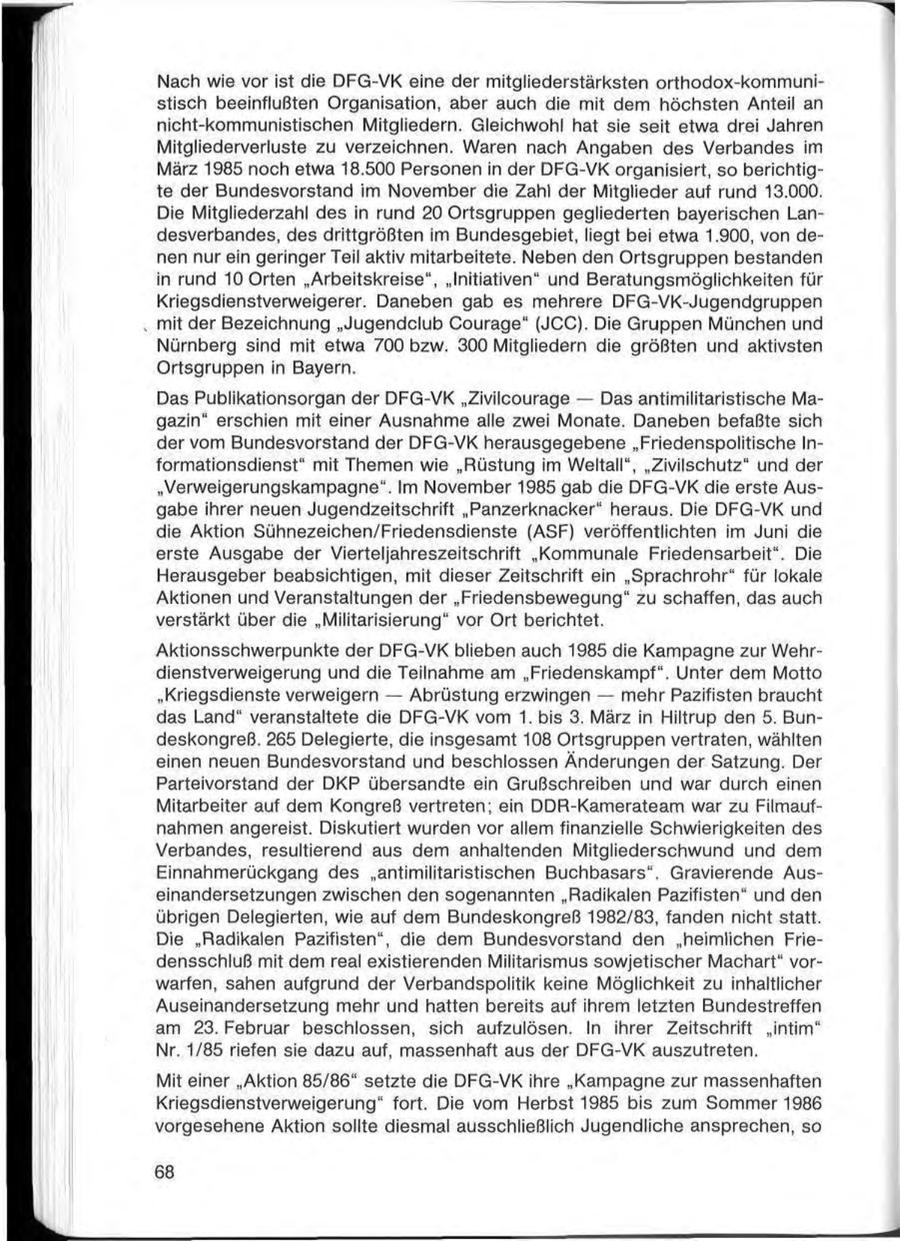
- Sechziger Jahre hervorgegangen sind. Ihr Ziel ist die kommunistische Gesellschaft. Sie lehnen jedoch -- anders als die DKP mit ihren Nebenorganisationen
- dogmatischen Organisationen legen die marxistisch-leninistischen Parteien und Bünde (K-Gruppen), die sich ursprünglich in weit stärkerem Maße nach
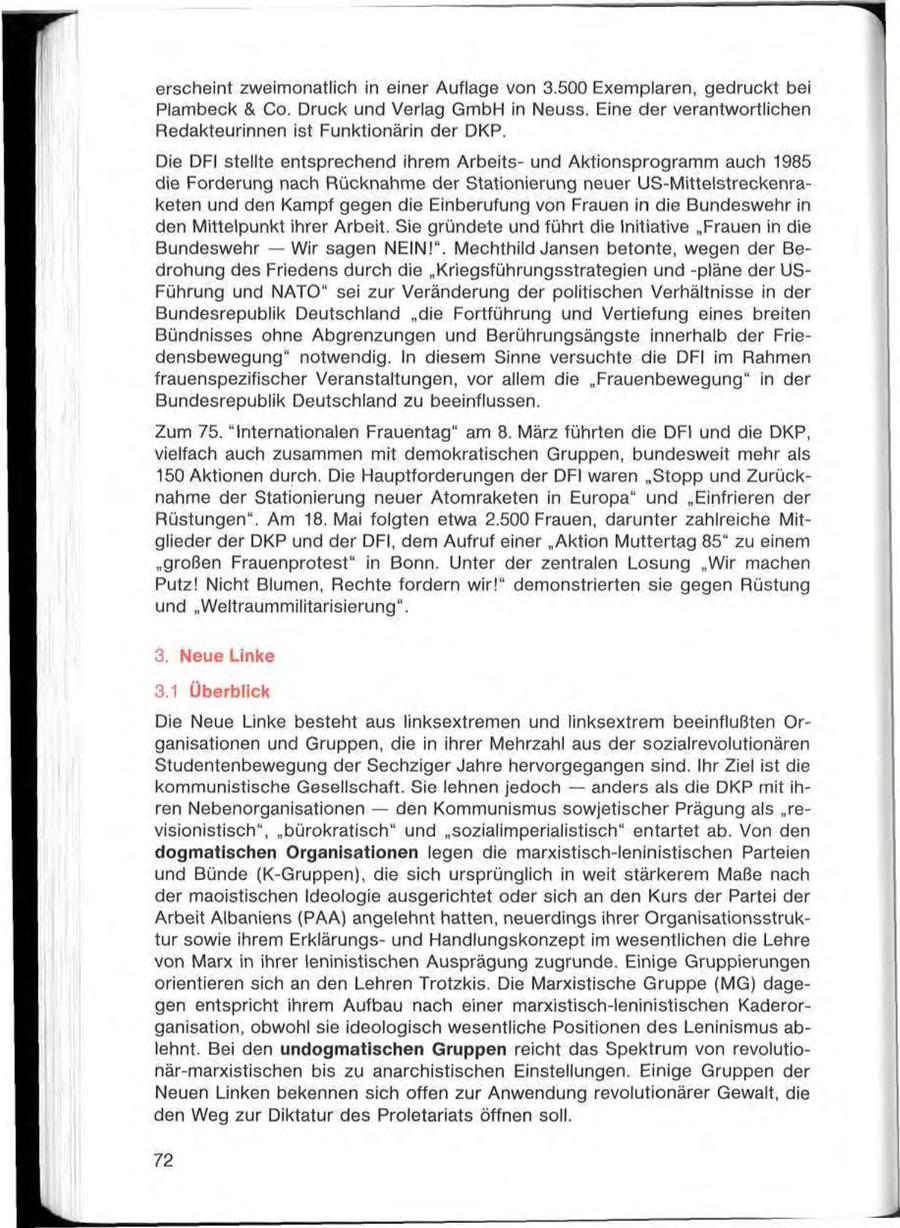
- setzte sich 1985 fort. Die Abkehr der Politik der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) vom starren Dogmatismus, der Tod des Staatsund
- ideologischen Unsicherheiten und Differenzen innerhalb der Gruppen und Parteien der dogmatischen Neuen Linken beigetragen. Darüber hinaus führte bei vielen Gruppen
- beachtlichen Mitgliederverlusten oder sogar zur Auflösung. So konnte der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) den seit Jahren drohenden Verfall trotz einschneidender
- dieser rückläufigen Entwicklung waren die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), die Marxistische Gruppe (MG) und der Arbeiterbund für den Wiederaufbau
- sahen ihr zentrales Anliegen in der Zusammenführung der zersplitterten kommunistischen Kräfte. Kennzeichnend für diese Bemühungen
- eine verstärkte Einheitsfront waren 1985 die Fusionsgespräche zwischen der Kommunistischen Partei Deutschlands (Marxisten-Leninisten) -- KPD -- und der Gruppe Internationale Marxisten
- gemeinsamen ZK-Sitzungen der KPD und des Bundes Westdeutscher Kommunisten (BWK) sowie die Herausgabe einer gemeinsamen Publikation, die als Beilage
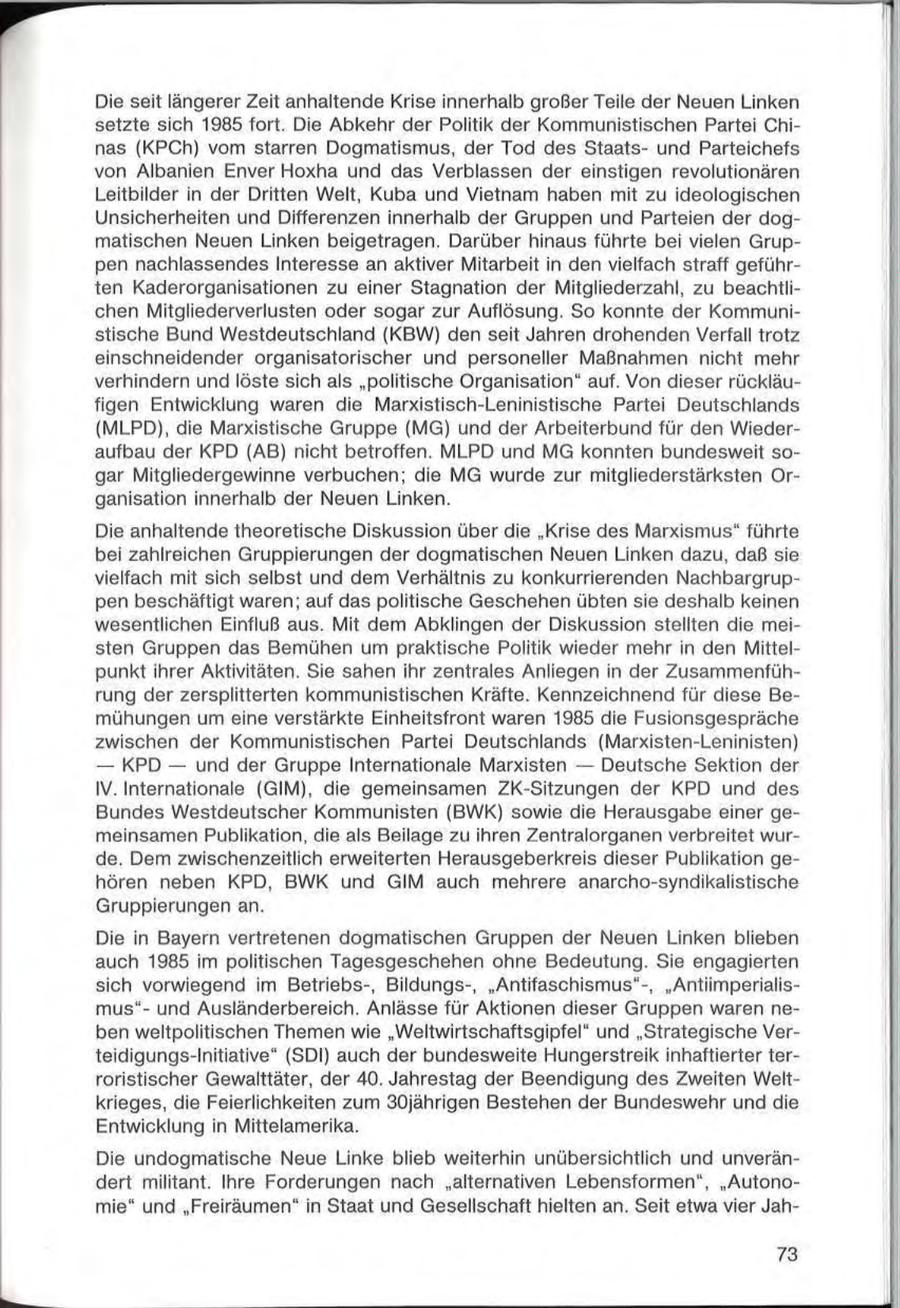
- gesamten Bundesgebiet. 3.2 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Die aus dem ehemaligen Kommunistischen Arbeiterbund Deutschlands (KABD) hervorgegangene, 1982 in Bochum
- Vorbereitung der Revolution. Nur unter Führung einer "revolutionären Partei" könne die Arbeiterklasse erfolgreich zum Sturm gegen den "staatsmonopolistischen Kapitalismus" übergehen
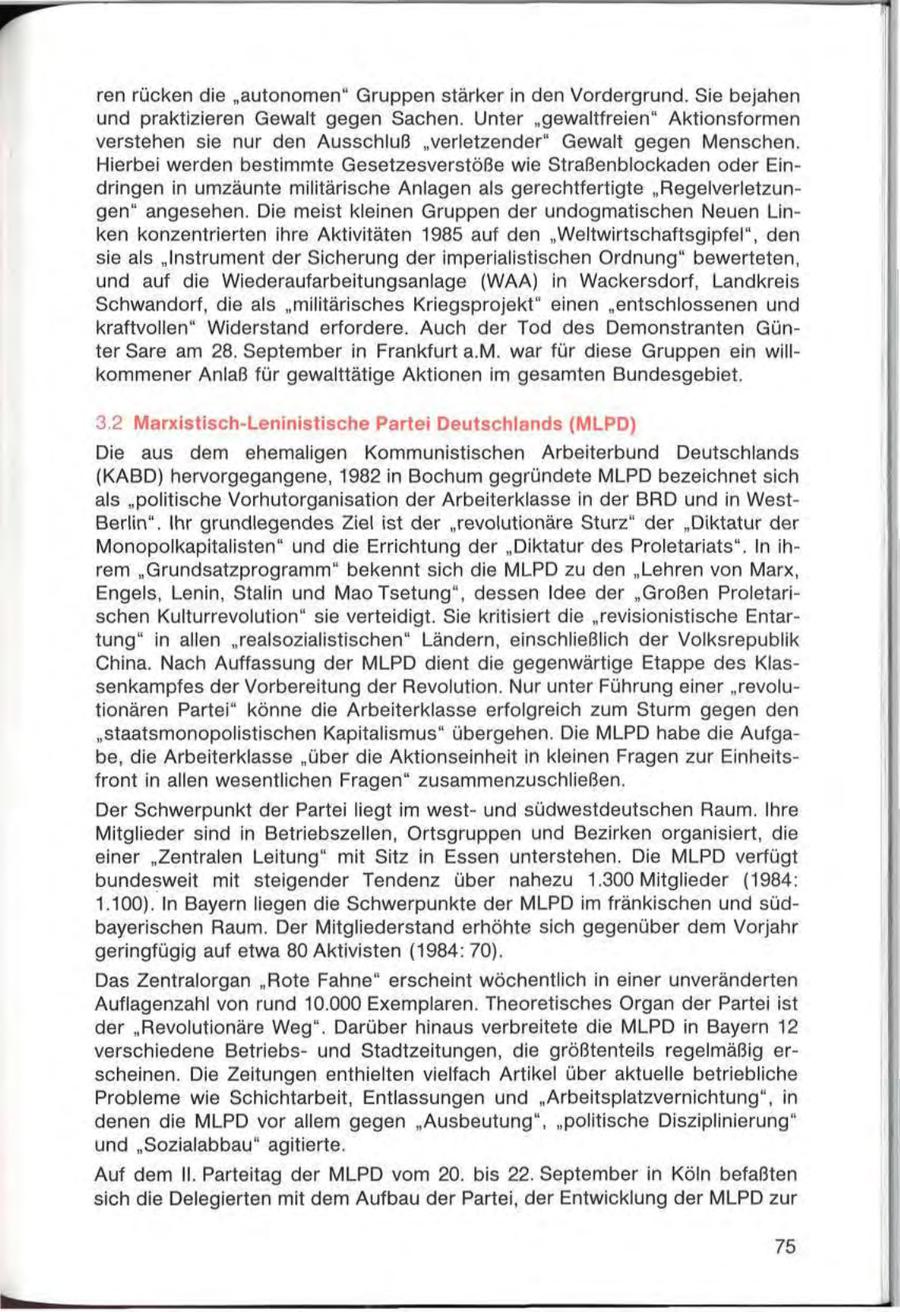
- Jugendarbeit, die künftig abgebaut werden sollen. 3.3 Kommunistische Partei Deutschlands (Marxisten-Leninisten) (KPD) Die Ende 1968 in Hamburg gegründete
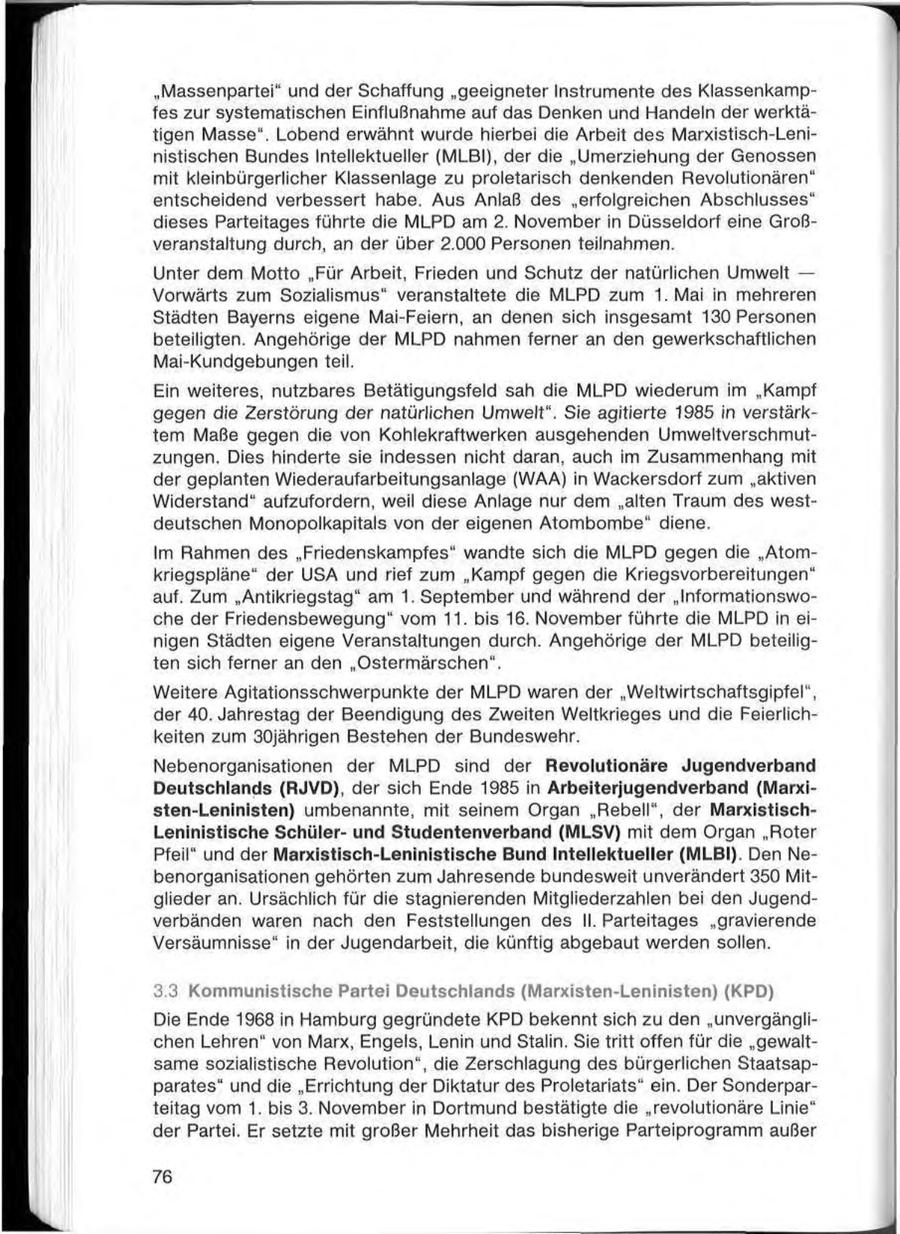
- einer "Zusammenlegung der Gefangenen aus RAF und Widerstand". 3.7 Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW) Der 1973 entstandene KBW bekannte sich
- Jahren andauernden Mitgliederschwund aufzufangen, änderte der KBW 1983 sein Parteikonzept und verabschiedete eine neue Satzung, die das Mitglied lediglich verpflichtete
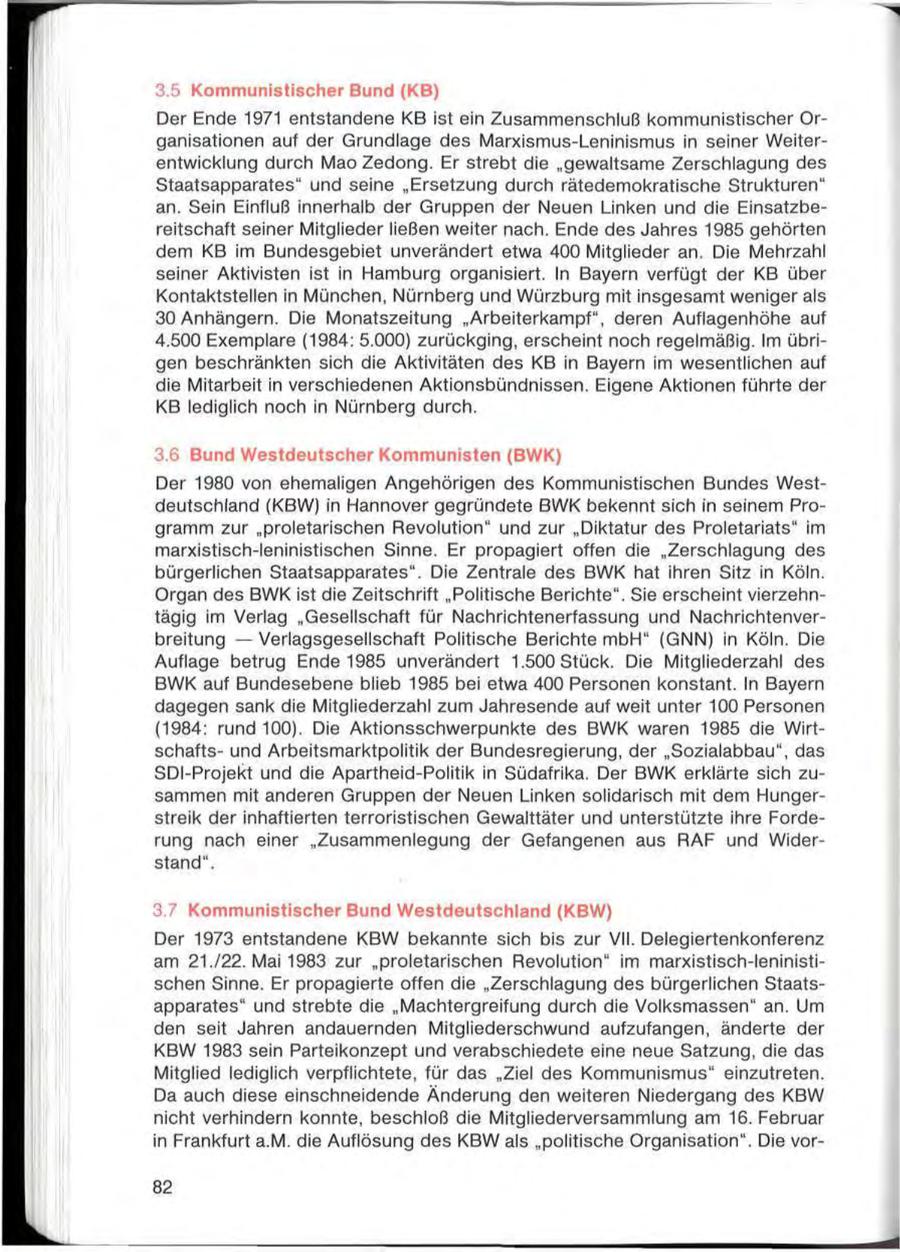
- Pläne zur Militarisierung des Weltalls". Aufgrund straffer Organisation und Parteidisziplin, ausreichender finanzieller Mittel und einer jahrelangen Erfahrung im Organisieren auch
- Einzelaktionen" wie Blockaden und "Umzingelungen". Der Protest des orthodox-kommunistisch orientierten traditionellen Flügels der "Friedensbewegung" richtete sich 1985 im wesentlichen
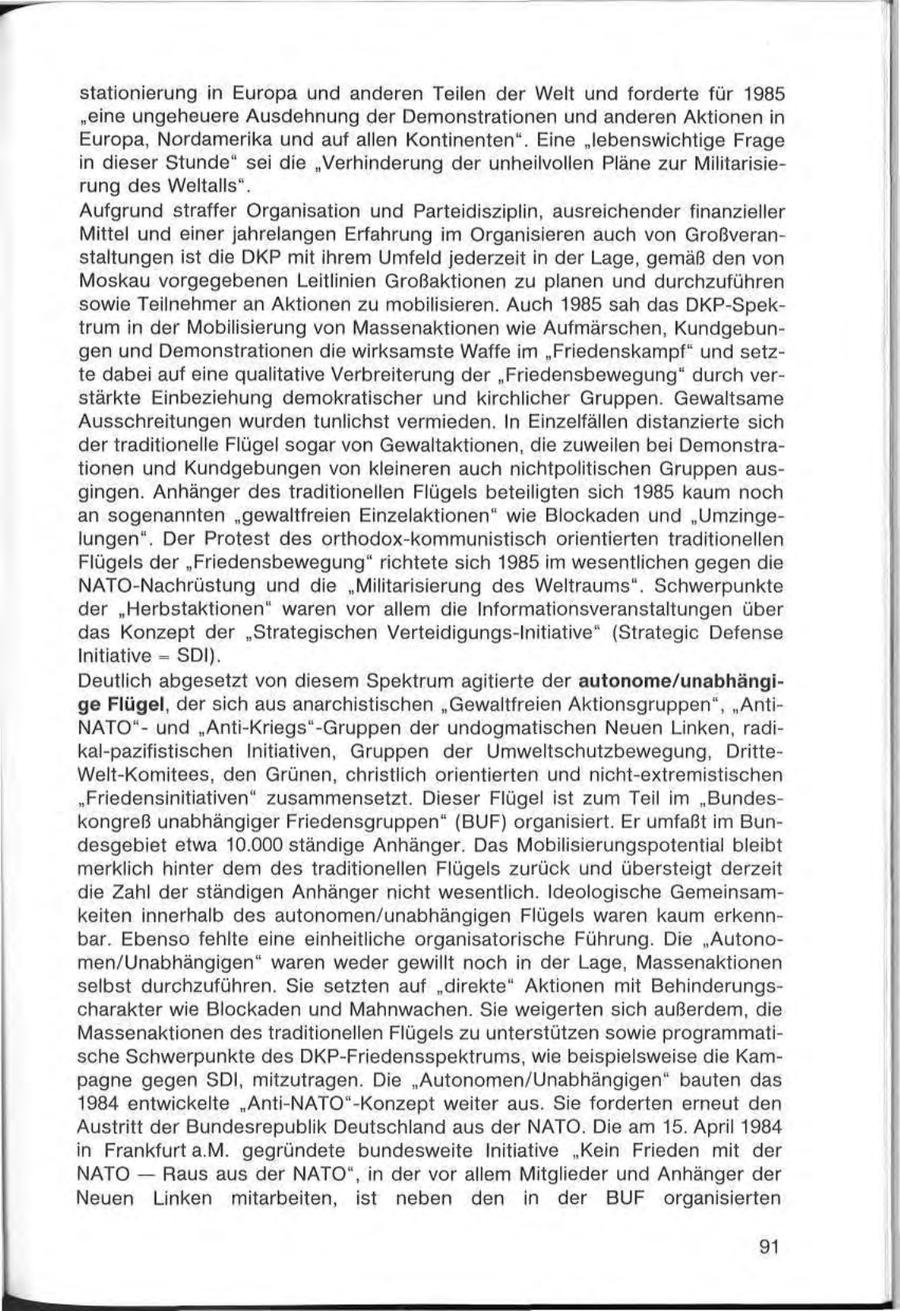
- verlorengegangenen Positionen zurückzuerobern. Wir brauchten "endlich wieder eine Deutsche Partei", die "die Ehre unseres Volkes wiederherstellt und sich weder durch
- für seine Rede "bei Juden, Zigeunern, Kommunisten, in Rußland, Polen, Israel oder New York und von notorischen Deutschenhassern bejubelt" werde
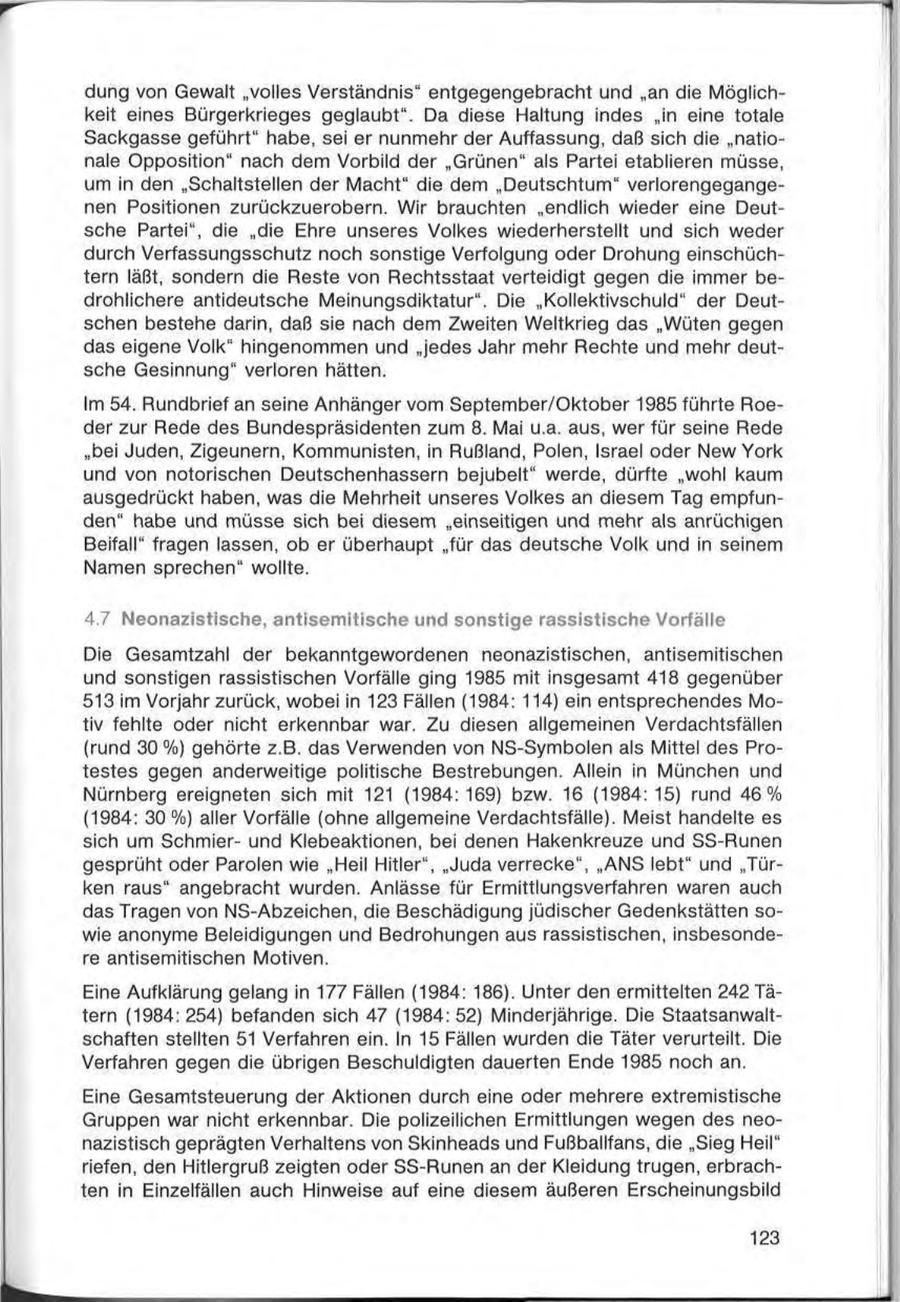
- Abschnitt Nr. 2.3.2) obliegt dem MSB Spartakus die Aufgabe, kommunistische Vorstellungen in den Hochschulbereich einzubringen und die Studenten hierfür
- sich der MSB Spartakus erneut zur DKP als der "Partei der Revolutionäre", die "die Gesamtalternative zu diesem System" verkörpere
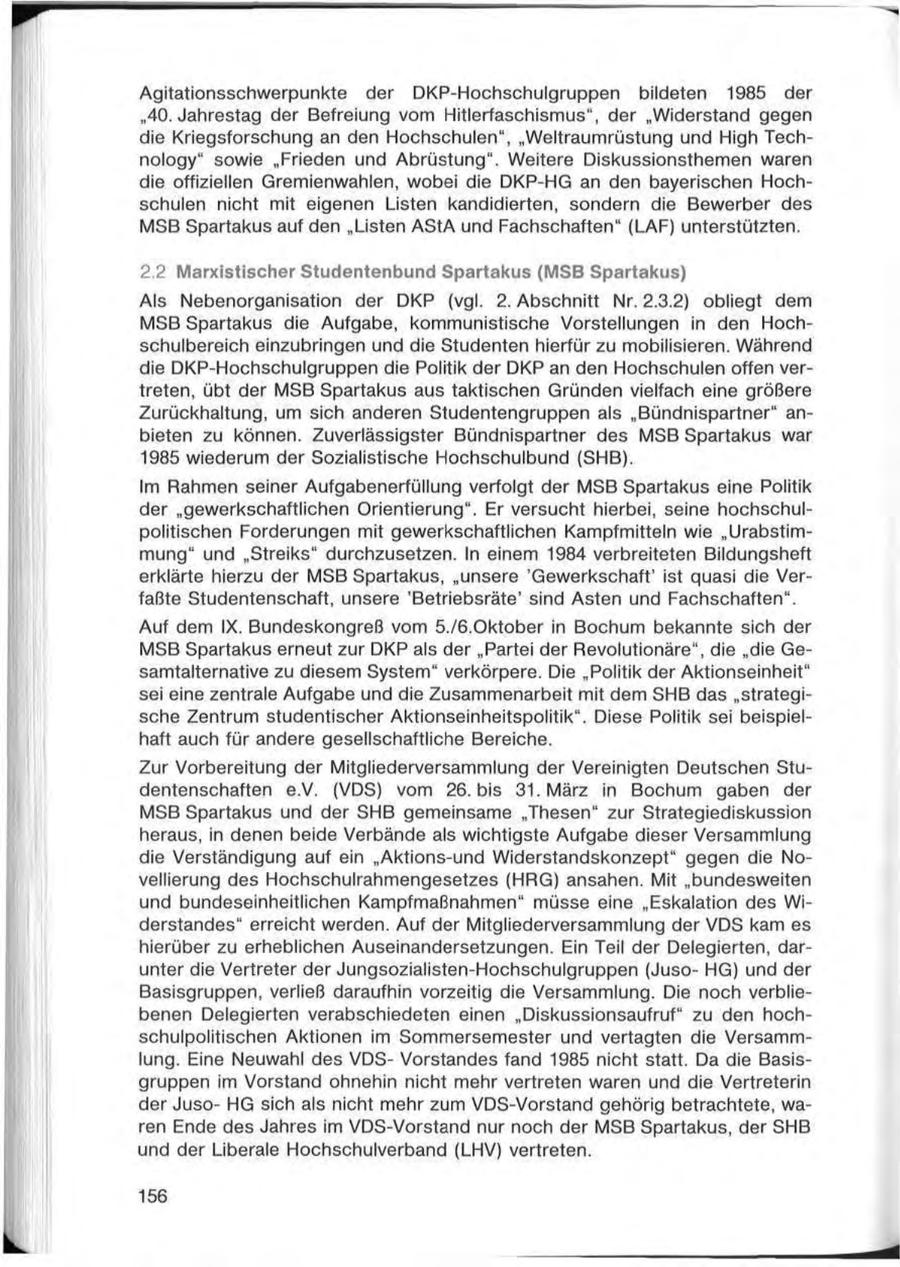
- Orthodoxe Kommunisten Die Kommunistische Partei der Türkei (TKP), die in der Türkei seit dem Jahre 1923 verboten ist, steuert ihre
- Bestrebungen der TKP, die Aufsplitterung der türkischen kommunistischen Vereinigungen im Bundesgebiet zu überwinden und dabei ihren eigenen Einfluß zu stärken
- Bayern. Die orthodoxkommunistisch beeinflußte FIDEF unterhält Verbindungen zur Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und deren Nebenorganisationen sowie zum Sozialistischen Hochschulbund
- beteiligten sich Mitglieder des M.I.DER sowie Vertreter weiterer orthodox-kommunistischer türkischer und kurdischer Organisationen am Pfingstcamp der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend
- Neuen Linken orientieren sich vorwiegend am Gedankengut der Türkischen Kommunistischen Partei/ Marxisten-Leninisten (TKP/ML) und der Türkischen Volksbefreiungspartei/ -front (THKP
- Türkei mit revolutionären Mitteln anstreben. Die Anhänger der Revolutionären Kommunistischen Partei der Türkei (TDKP) traten 1985 in Bayern nicht öffentlich
- Erscheinung. 12.2.1 Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) Die proalbanische TKP/ML wurde im Jahre 1972 illegal in der Türkei gegründet. Im Jahre