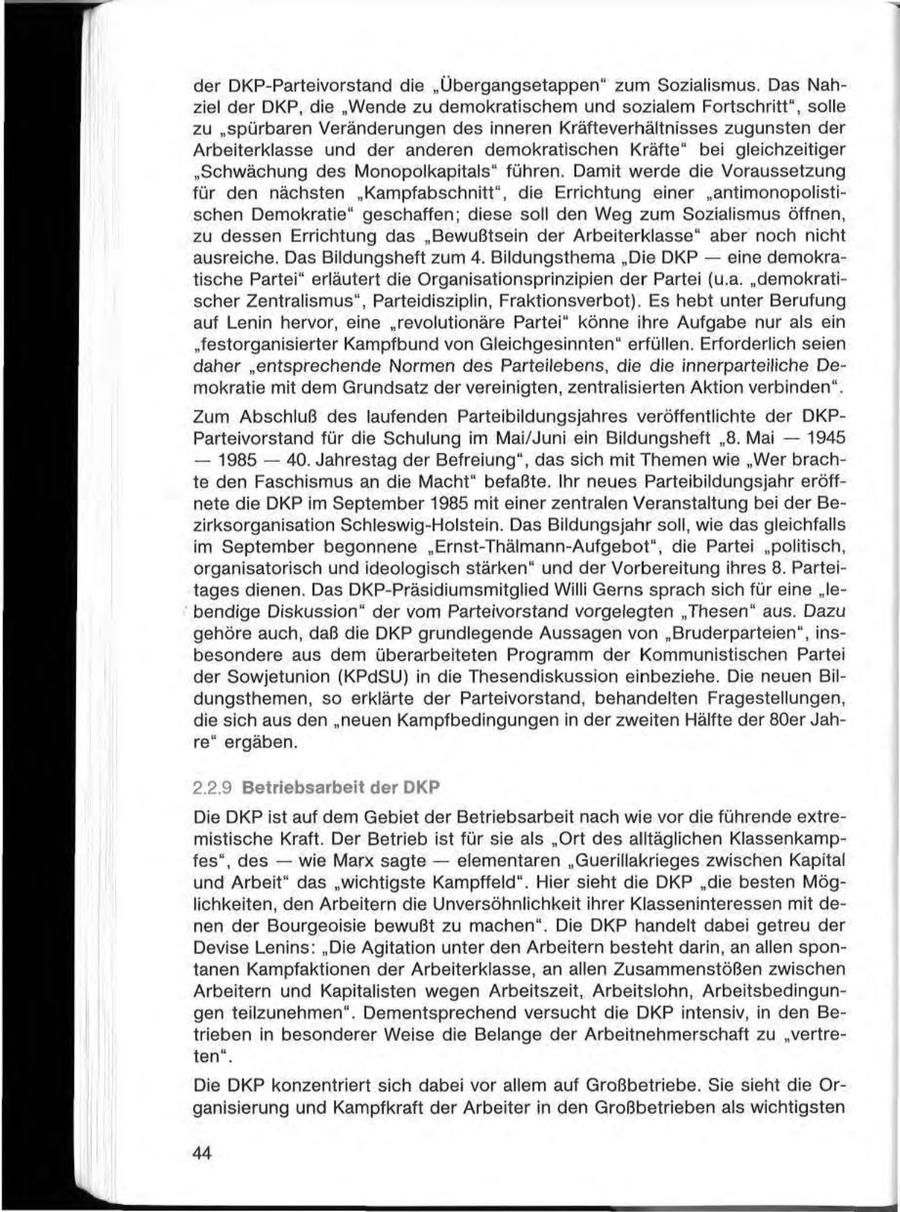Verfassungsschutz Suche
Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.
Treffer auf 10776 Seiten
"kommunistische partei" in den
Verfassungsschutz Trends
- Arbeiterklasse, die Kommunistische Partei, ausgeübt; die Gewaltenteilung ist beseitigt. In der Phase der Diktatur des Proletariats gibt es allerdings noch
- Sozialismus, aufhören zu existieren. Dann führt allein die Kommunistische Partei den sozialistischen Staat und die sozialistische Gesellschaft. Auf dem Höhepunkt
- Haltung zur Sowjetunion" als "entscheidenden Prüfstein für jeden Kommunisten, für seine Treue zur Sache der revolutionären Arbeiterbewegung" und "erzieht ihre
- sozialistische und kommunistische Gesellschaftsordnung. Dies ergibt sich aus ihrem am 21. Oktober 1978 auf dem Mannheimer Parteitag beschlossenen Programm
- proletarischen Internationalismus. Die Partei hält am "unverrückbaren Ziel" des Sozialismus, "als erster Phase der kommunistischen Gesellschaftsformation", fest. Diese "grundlegend neue
- Errichtung des Sozialismus in der Bundesrepublik Deutschland. Als die Partei des "Klassenkampfes" und des "Sozialismus" bekennt sie sich
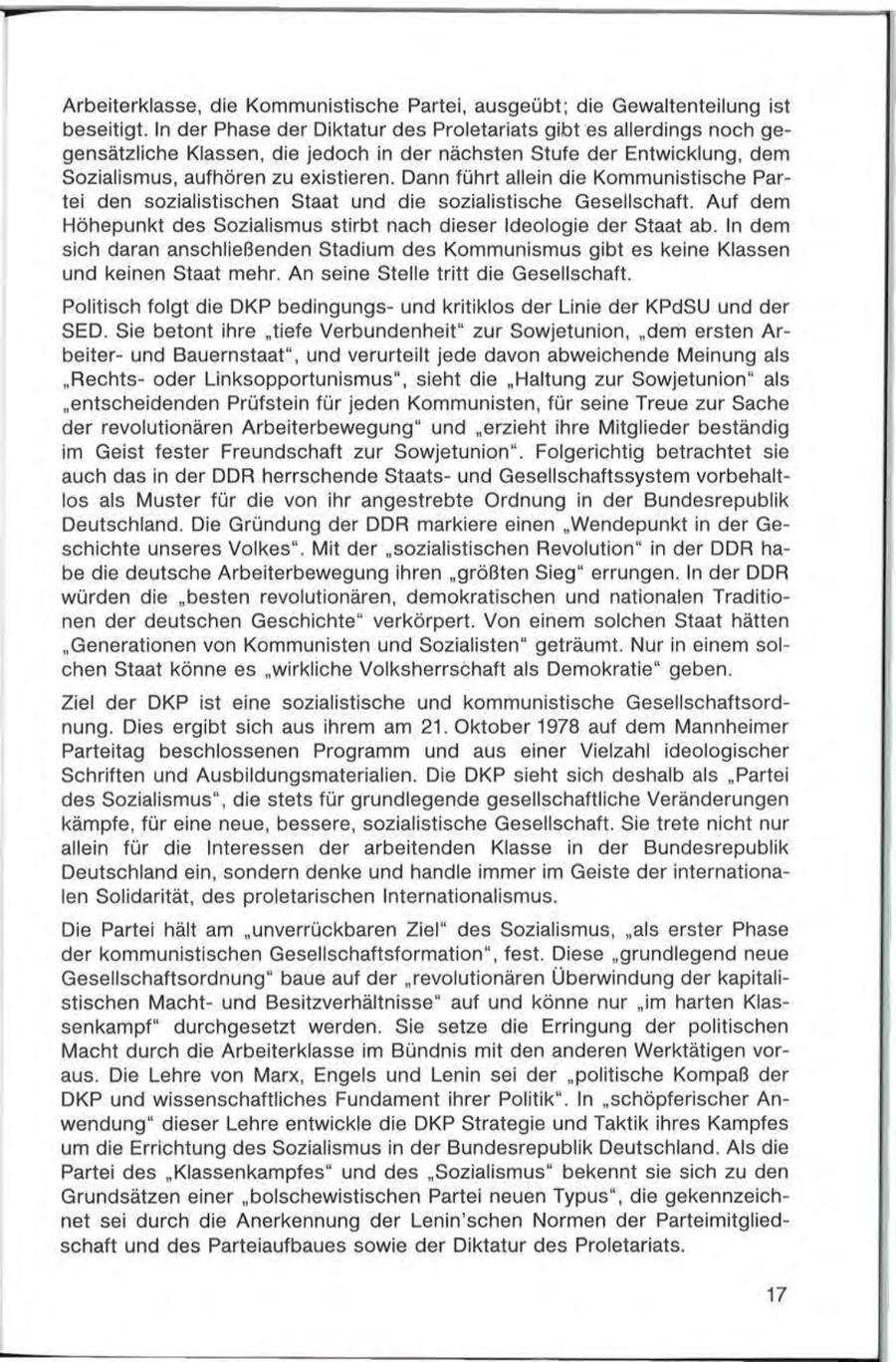
- ihre sozialistische Zielsetzung, ihre Zugehörigkeit zur kommunistischen Weltbewegung" grundsätzlich von allen anderen Parteien unterscheide. Sie bekräftigt ihre bedingungslose
- Loyalität zur KPdSU als der "stärksten und erfahrensten Partei der kommunistischen Weltbewegung". Erneut bekundet sie ihre Verbundenheit
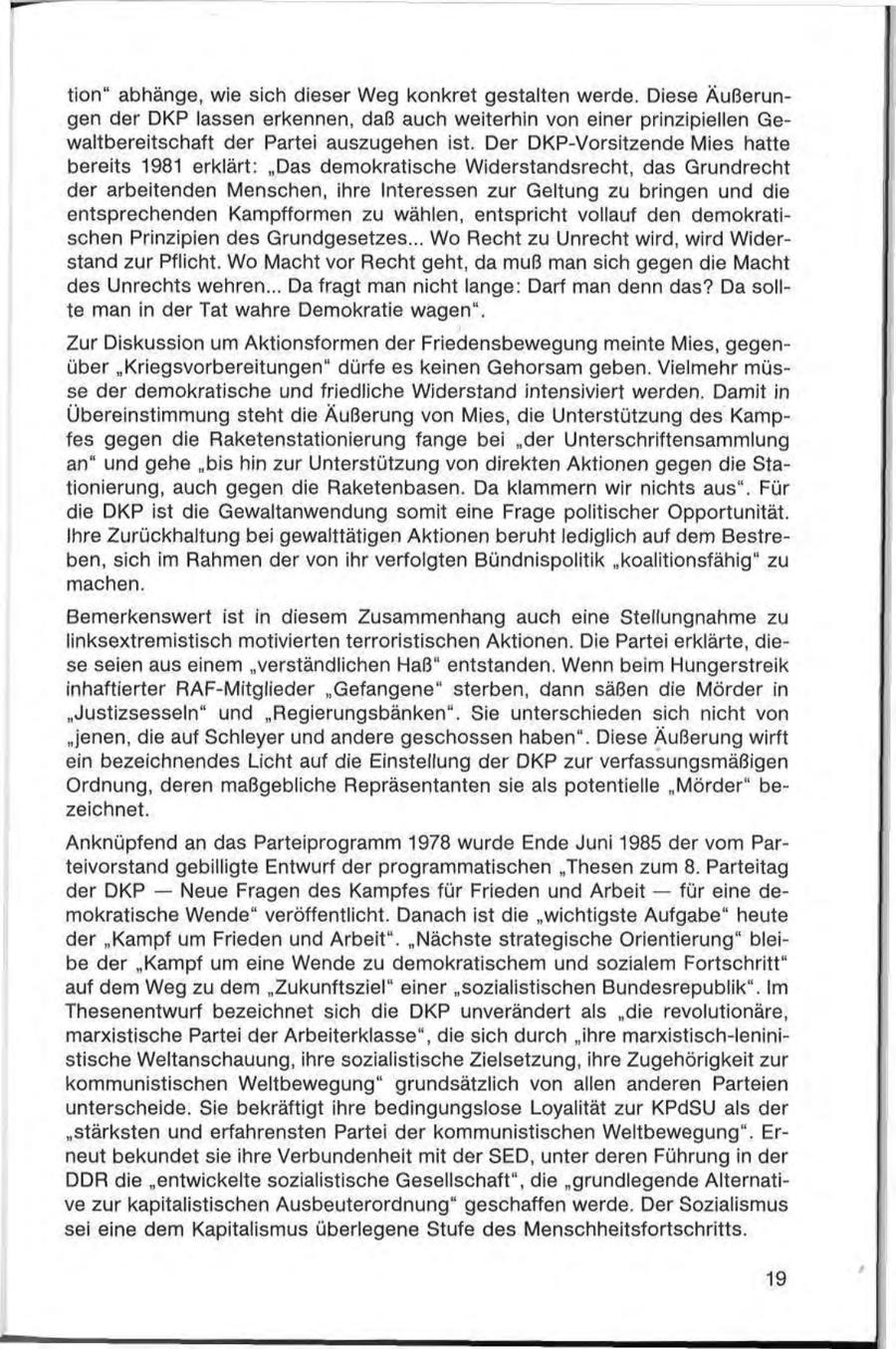
- umfassend unterstützt. Die im Entwurf der "Thesen zum 8. Parteitag -- Neue Fragen des Kampfes für Frieden und Arbeit -- für eine
- für die Schulung, Förderung und Betreuung westdeutscher Kommunisten zur Verfügung stellt. Hierzu zählen auch die Ferienaktionen der DKP-Nebenorganisation Junge
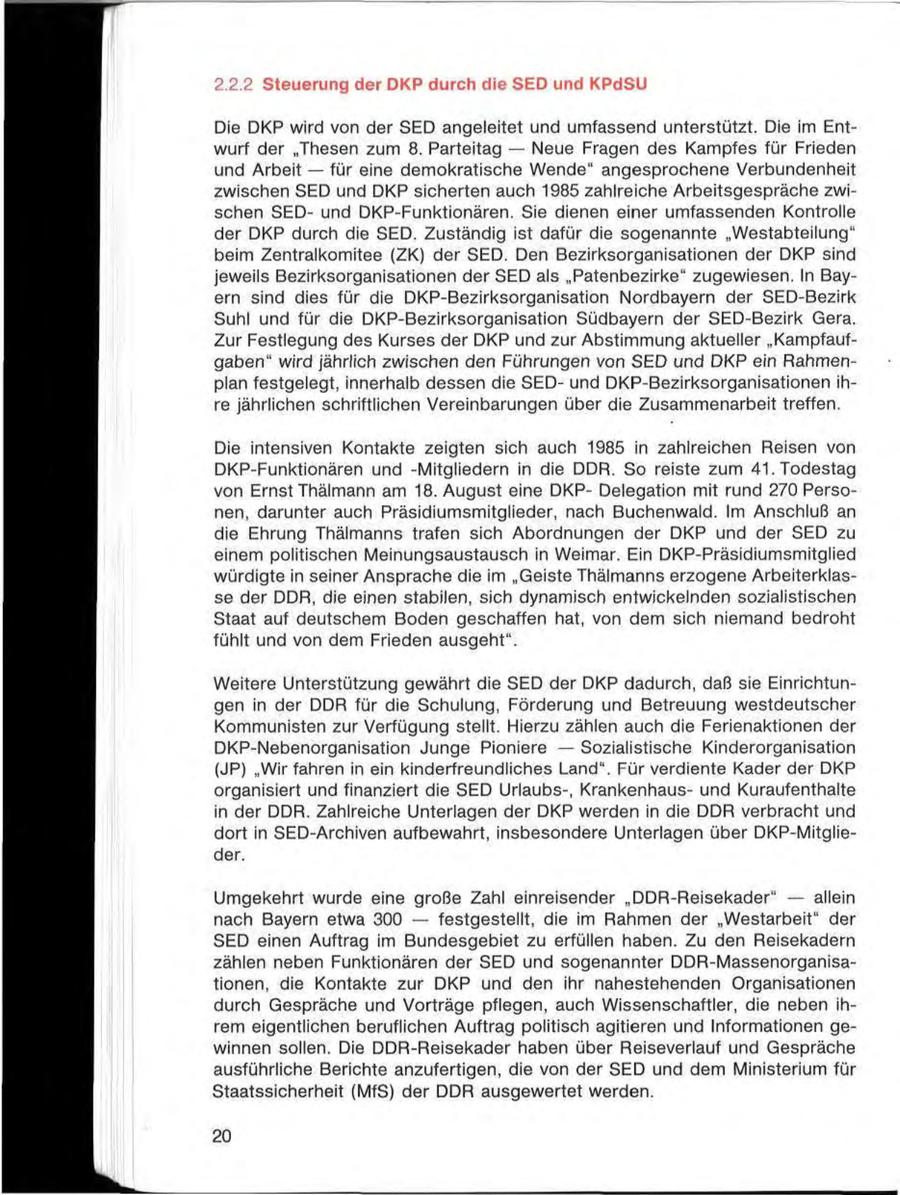
- engen Beziehungen zwischen Verlagen in der DDR und kommunistischen Verlagen in der Bundesrepublik Deutschland. Die strikte Anbindung
- durch die DKP macht deutlich, in welchem Maß die Partei an die Politik der SED gebunden ist. Auch die Steuerung
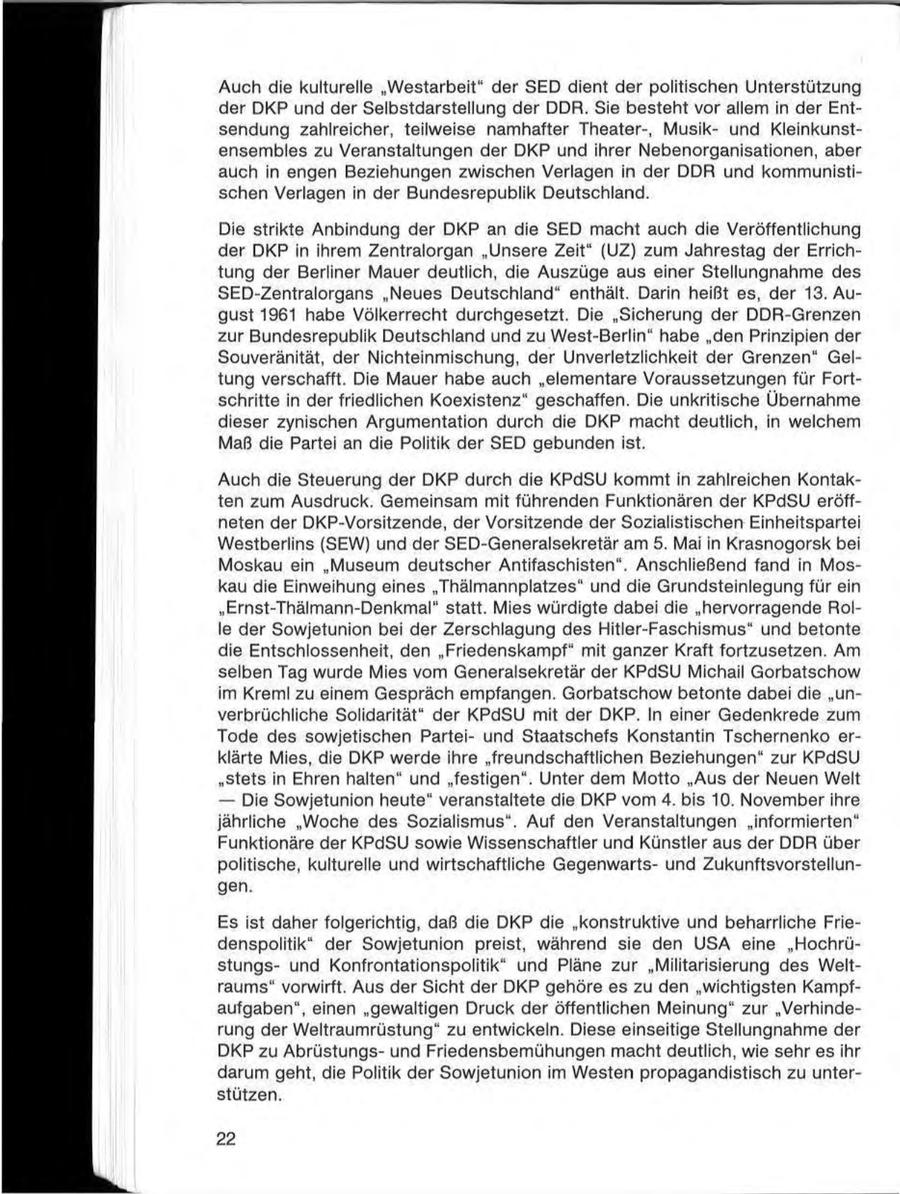
- Prinzipien des proletarischen Internationalismus ihre freundschaftlichen Beziehungen zu anderen kommunistischen Parteien durch gegenseitige Besuche, Treffen und Teilnahme an internationalen Großveranstaltungen
- kommunistischer Parteien. Die DKP-Pressemeldungen stellten derartige Begegnungen besonders heraus. Auf Einladung der DKP berieten
- Juni im MarxEngels-Zentrum in Wuppertal Vertreterinnen von 16 kommunistischen Parteien aus Westeuropa über die Lage der Frauen
- Juni trafen sich in Paris Vertreter von 18 westeuropäischen kommunistischen Parteien, darunter auch
- Krise" in den westeuropäischen Ländern analysiert und über "Aktionen kommunistischer Parteien" beraten werden. Am 15. Juni trafen sich die Vorsitzenden
- Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) und der Kommunistischen Partei Luxemburgs (KPL) in Trier zu einem "freundschaftlichen Meinungsaustausch" über Fragen der "internationalen
- Vorsitzende einen "Solidaritätsbrief" an den Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Japans. Darin hieß es: "In unserem Land verstärken demokratische
- Broschüre mit dem Titel "Die DKP -- Eine demokratische Partei", die anläßlich des DKP-Bildungsjahres 1984/85 herausgegeben wurde, beschreibt
- Anforderungen, die an ihre Mitglieder gestellt werden. "Da die kommunistische Partei ein freiwilliger Kampfbund von Gleichgesinnten ist, erhält derjenige
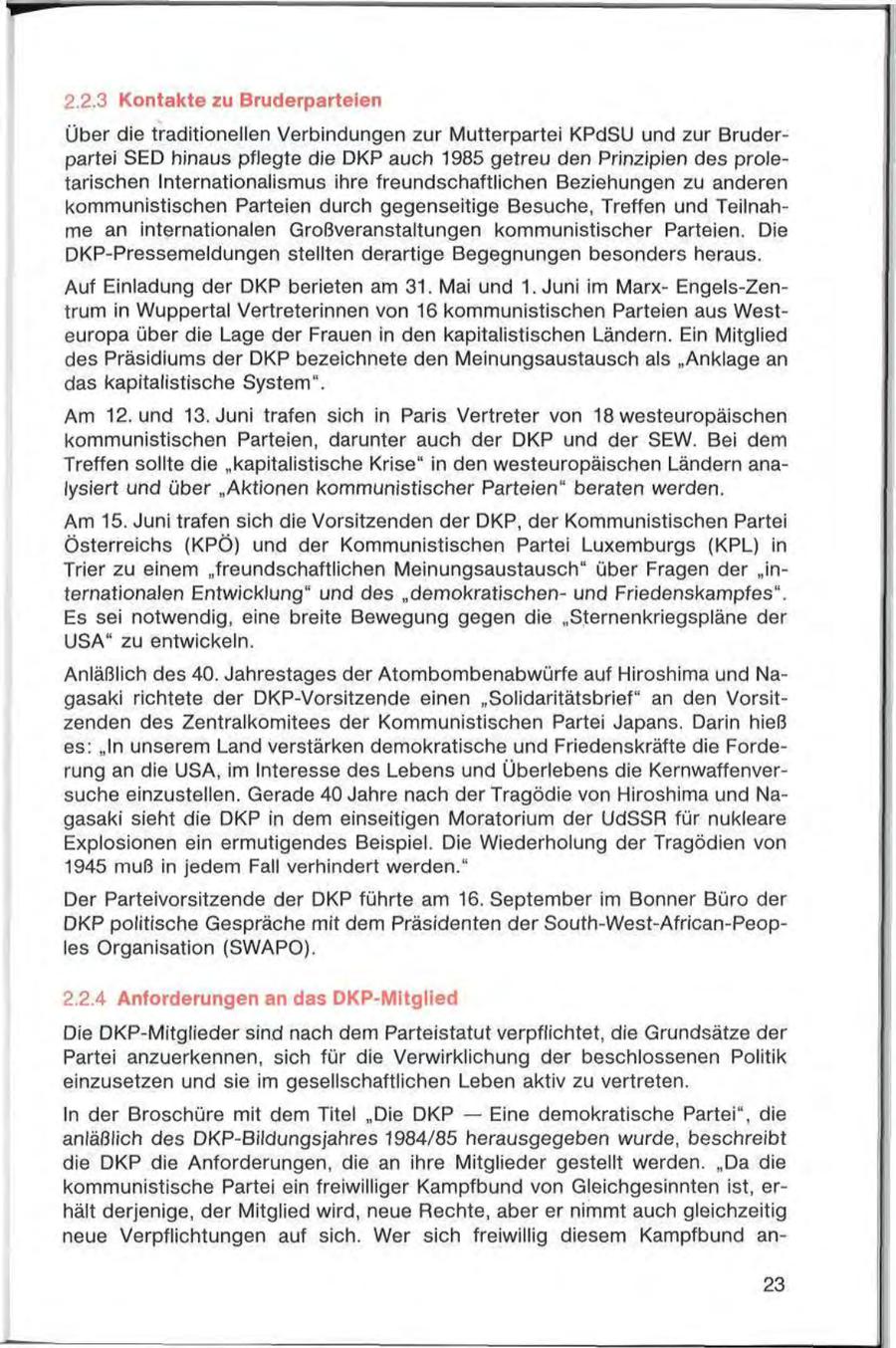
- Gestaltung der DKP-Presse mitzuwirken". Kommunist sein heiße, aus Klassenbewußtsein ein disziplinierter Kämpfer der Partei der Arbeiterklasse zu sein, heiße
- Linie der Partei einzuschwören. Entsprechend den Leninschen Gedanken zum Parteiaufbau sieht sich die DKP nicht als Massenorganisation, sondern als Elite
- große Mehrheit der Anleitung durch Mitglieder des Führungskaders, der Kommunistischen Partei, bedarf, die aus der "Masse" herausragen und zur Führung
- liegt klar auf den Hand. Auf dem 7. Parteitag im Januar 1984 hatte die DKP das Emst-Thälmann-Aufgebot beschlossen
- ließ sich dabei von dessen "Vermächtnis" leiten: -- "Kommunisten wirken unermüdlich für die Aktionseinheit der Arbeiterklasse, ohne die sie keine durchgreifenden
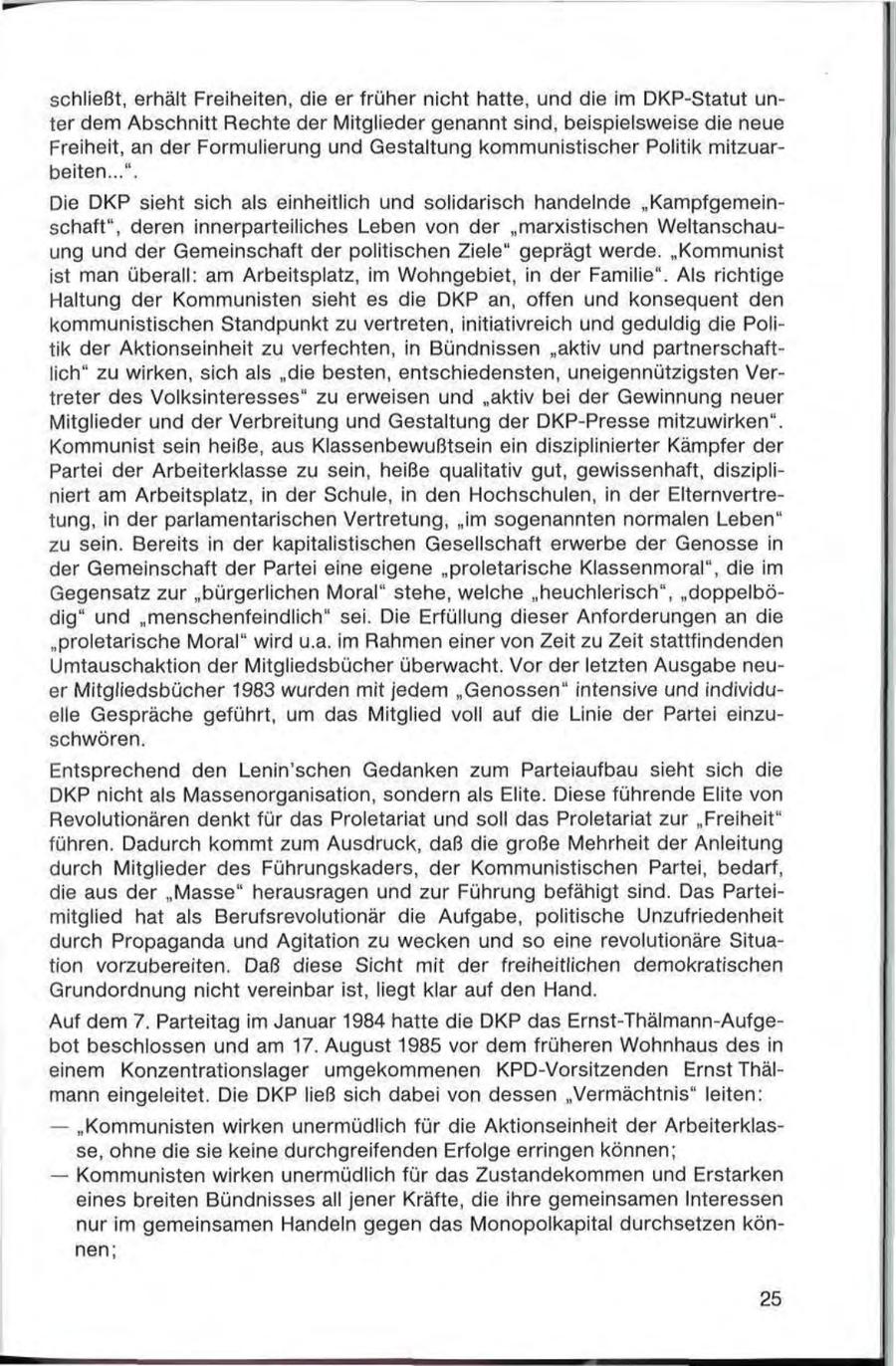
- Macht erkämpfte: zur Sowjetunion; -- Kommunisten verlieren niemals aus den Augen, daß die Stärkung ihrer Partei ein unverzichtbares Erfordernis für

- nach Lenin unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei. Nach einem weiteren UZ-Artikel hatten die Teilnehmer eines Meinungsund
- Geschlossenheit" entschieden habe; Empfehlungen "kritischer Kommunisten", in der DKP auch "Fraktionen" zuzulassen, habe die Partei zurückgewiesen. In ihrem Anfang
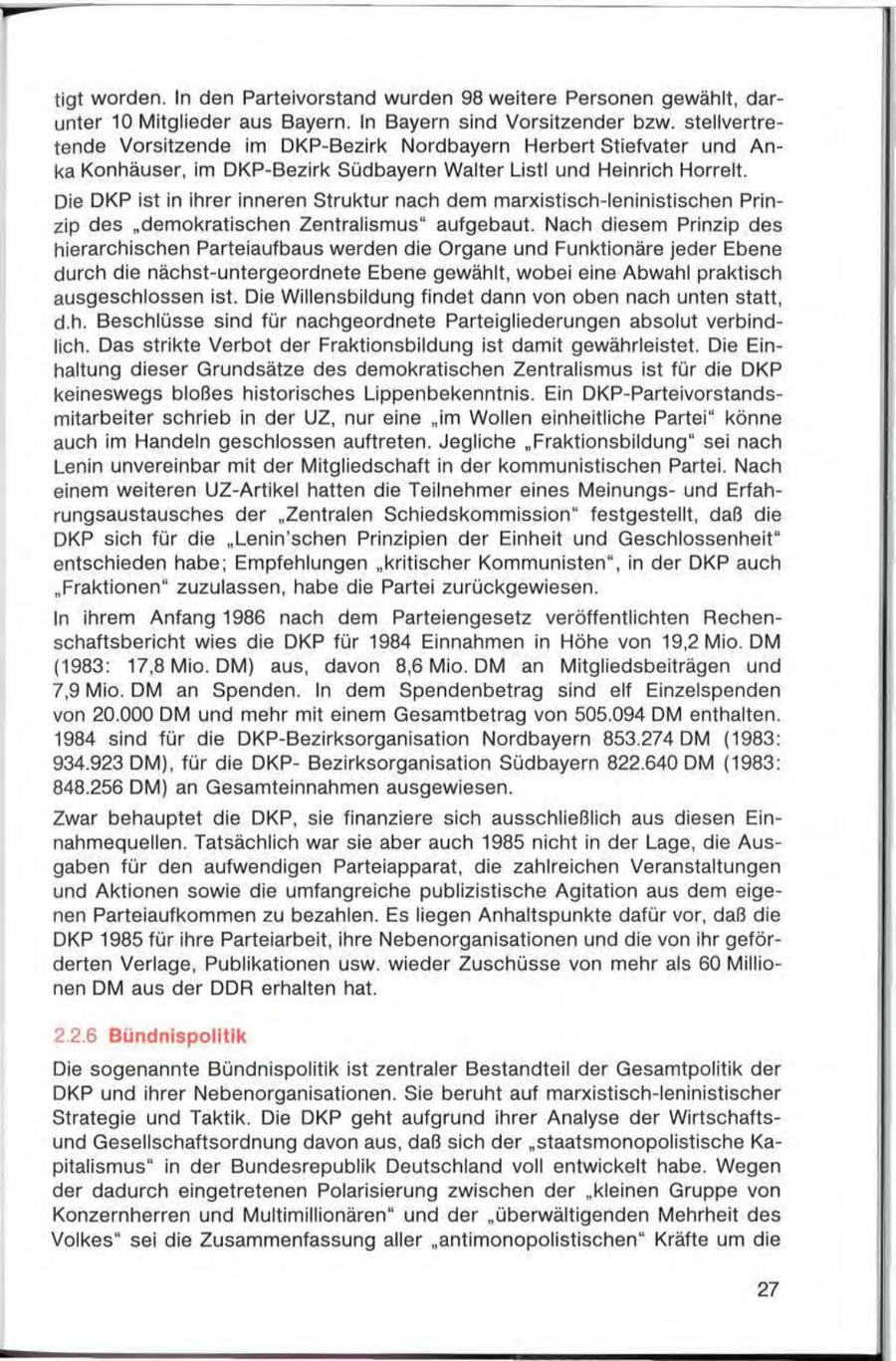
- schwaches Wählerpotential ist die DKP bestrebt, Bündnisse mit nicht-kommunistischen Kräften in der "Aktionseinheit der Arbeiterklasse" und in einem "breiten
- versucht sie, mit der Bündnispolitik demokratische Kräfte an die Partei heranzuführen. Für eine erfolgreiche Politik der "Aktionseinheit und des demokratischen
- Endziel kein Zweifel bestehen kann: die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft. Der Parteivorstand veröffentlichte im März 1983 im "Bildungsheft" "Grundsätze kommunistischer
- denn ein Verzicht auf Selbständigkeit bedeute das "Ende einer kommunistischen Partei"; -- Kommunisten sollten -- durch Schulung befähigt -- in den Bewegungen
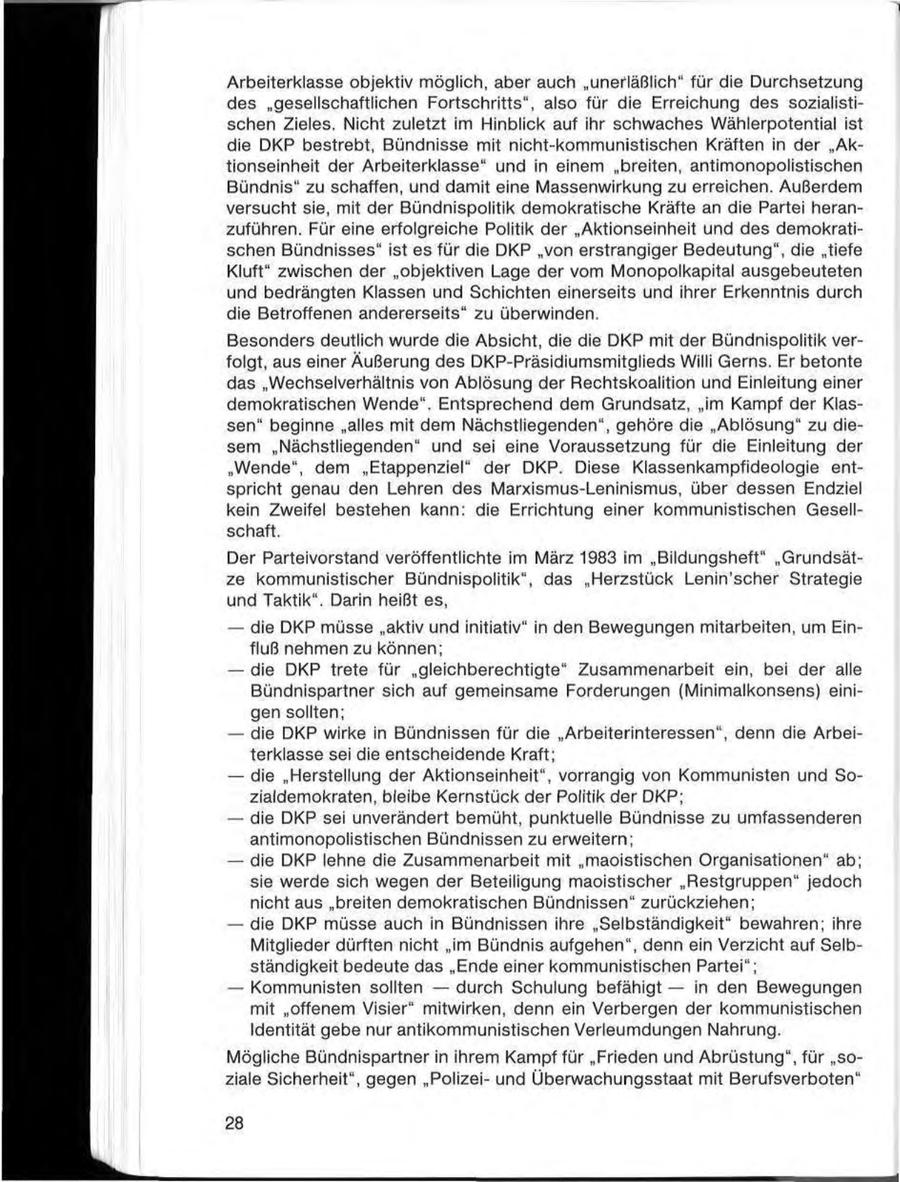
- Kräfte für den Frieden sind weiter vorangekommen", der Partei sei es gelungen, in der "Zeit seit der Rechtswende" in ihrer
- sich für eine "Weiterentwicklung des politischen Zusammengehens von Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen und Grünen in allen Bereichen des Friedenskampfes" einsetzen
- wurde, bekräftigte der DKP-Vorsitzende Mies das Angebot seiner Partei zum "Dialog von Christen und Marxisten". Angesichts der Bedrohung durch
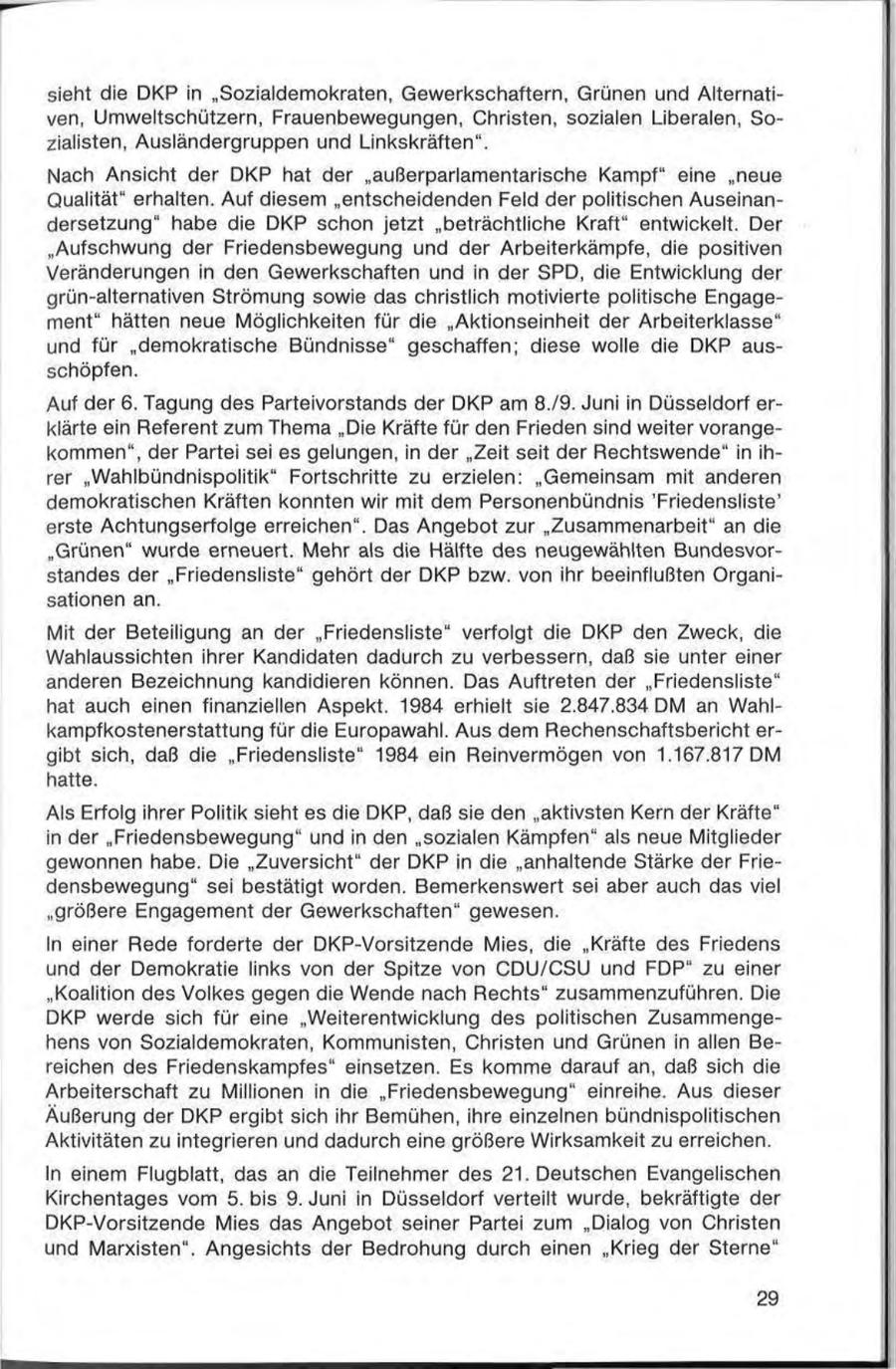
- Ökonomie", "Strategie und Taktik der Arbeiterbewegung" und "Manifest der kommunistischen Partei" statt. Vom 11. bis 18. August veranstaltete die SDAJ
- VictorJara-Treffen. Daran beteiligten sich nach Berichten der kommunistischen Presse rund 200 Laienund Berufskünstler, Liedermacher, Schauspieler, Musiker und Kulturinteressierte

- Beamten, deutschen und ausländischen Kollegen, sozialdemokratischen und kommunistischen, christlichen und parteilosen Arbeitern" zu erreichen. Auf dem 7. Parteitag
- Führung gegen die DKP die "Mauer" zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten "an vielen Teilen durchbrochen"; die Zusammenarbeit vollziehe sich "innerhalb
- neue Ansatzpunkte für die Aktionseinheit". Auf der 3. DKP-Parteivorstandstagung beschwor Mies erneut die Notwendigkeit der "Aktionseinheit
- Arbeiterklasse"; je intensiver Sozialdemokraten und Kommunisten zusammenarbeiteten, desto eher würden auch parteilose und christliche Arbeiter zum Mitkämpfen bewegt. "Aktionseinheit
- Kommunisten fördere das "Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte im Rahmen von Bündnissen". Auch auf der 5. Tagung des Parteivorstands
- Fragen der konkreten Politik", so Mies, stimmten Positionen von Kommunisten und Sozialdemokraten überein. Nach wie vor bestünden große Unterschiede

- ihnen zu bleiben und in ihnen um jeden Preis kommunistische Arbeit zu leisten. Etwa 75 v.H. der DKP-Mitglieder sind
- Wirtschaftsund Sozialpolitik/Gewerkschaftsspiegel", die von drei Mitgliedern des DKP-Parteivorstandes und einem langjährigen DFU-Funktionär herausgegeben werden. Der DKP-Vorsitzende versicherte
- revolutionäre Situation" zu fördern. Der DKP-Vorsitzende erklärte, die Kommunisten würden bei den Herbstaktionen der "Friedensbewegung" und der Gewerkschaften
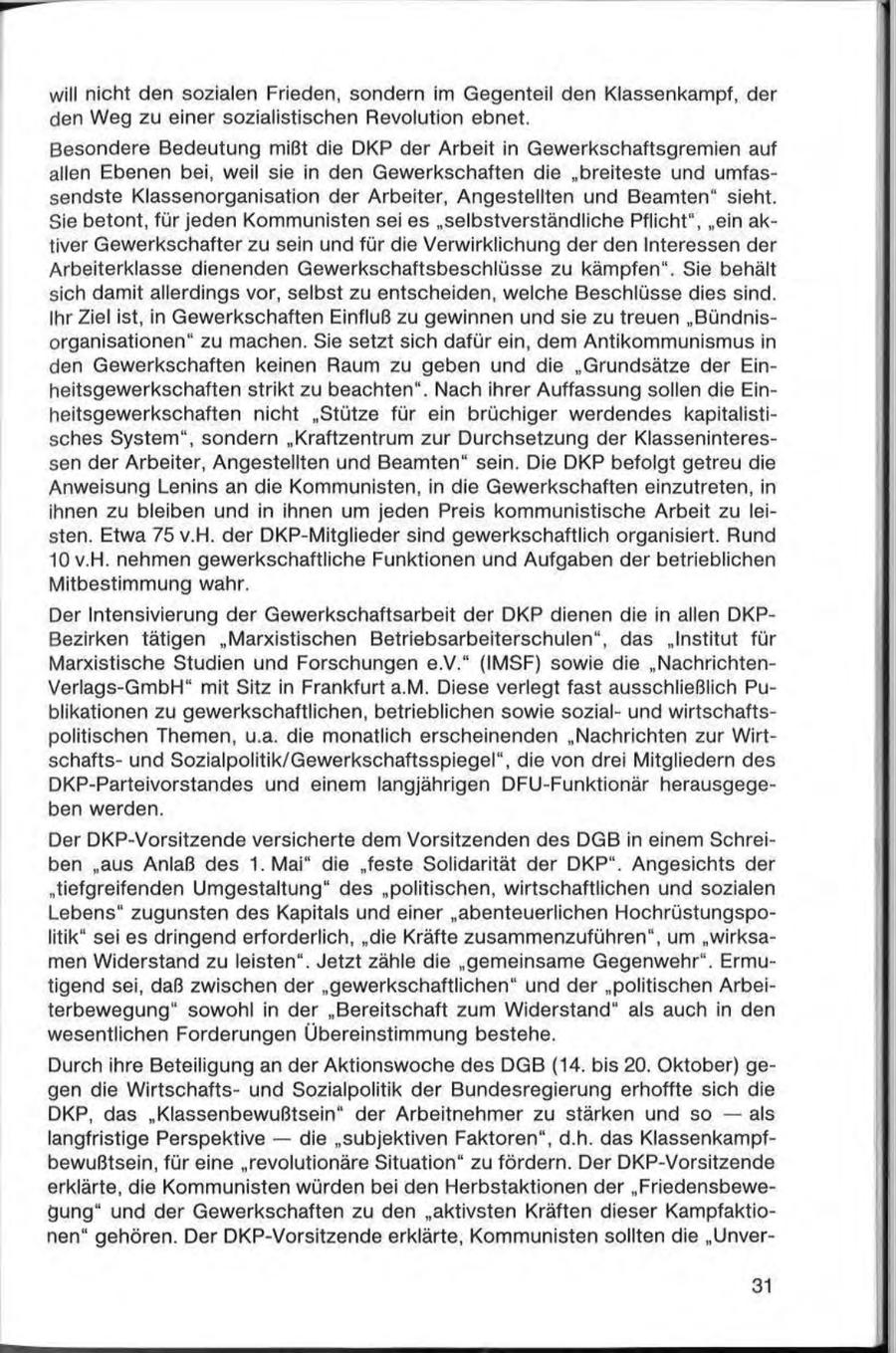
- bündnisfähigen, tagespolitischen Zielsetzungen und ihrem Endziel, der Schaffung einer kommunistischen Gesellschaft, besteht. Ihre Beteiligung an der Aktionswoche des DGB diente
- Sozialabbau". "Neue Möglichkeiten" für die "Aktionseinheit" mit demokratischen Parteien sieht Mies bei der Abrüstungs-, Sozialund Bildungspolitik sowie beim Kampf gegen
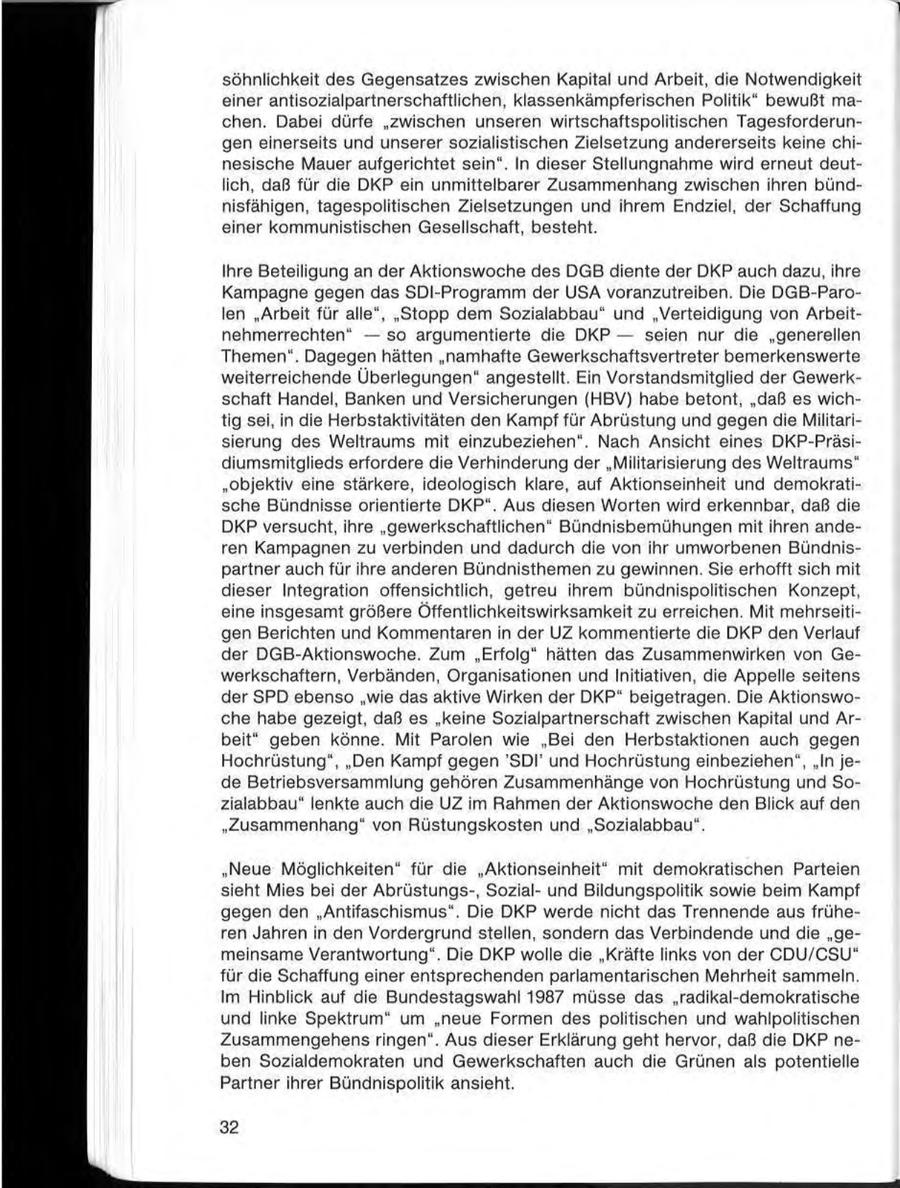
- Dabei versucht die Partei jedoch, propagandistisch einen Bezug dieser tagespolitisch bestimmten, aktuellen Forderungen zu ihrer langfristigen kommunistischen Zielsetzung herzustellen
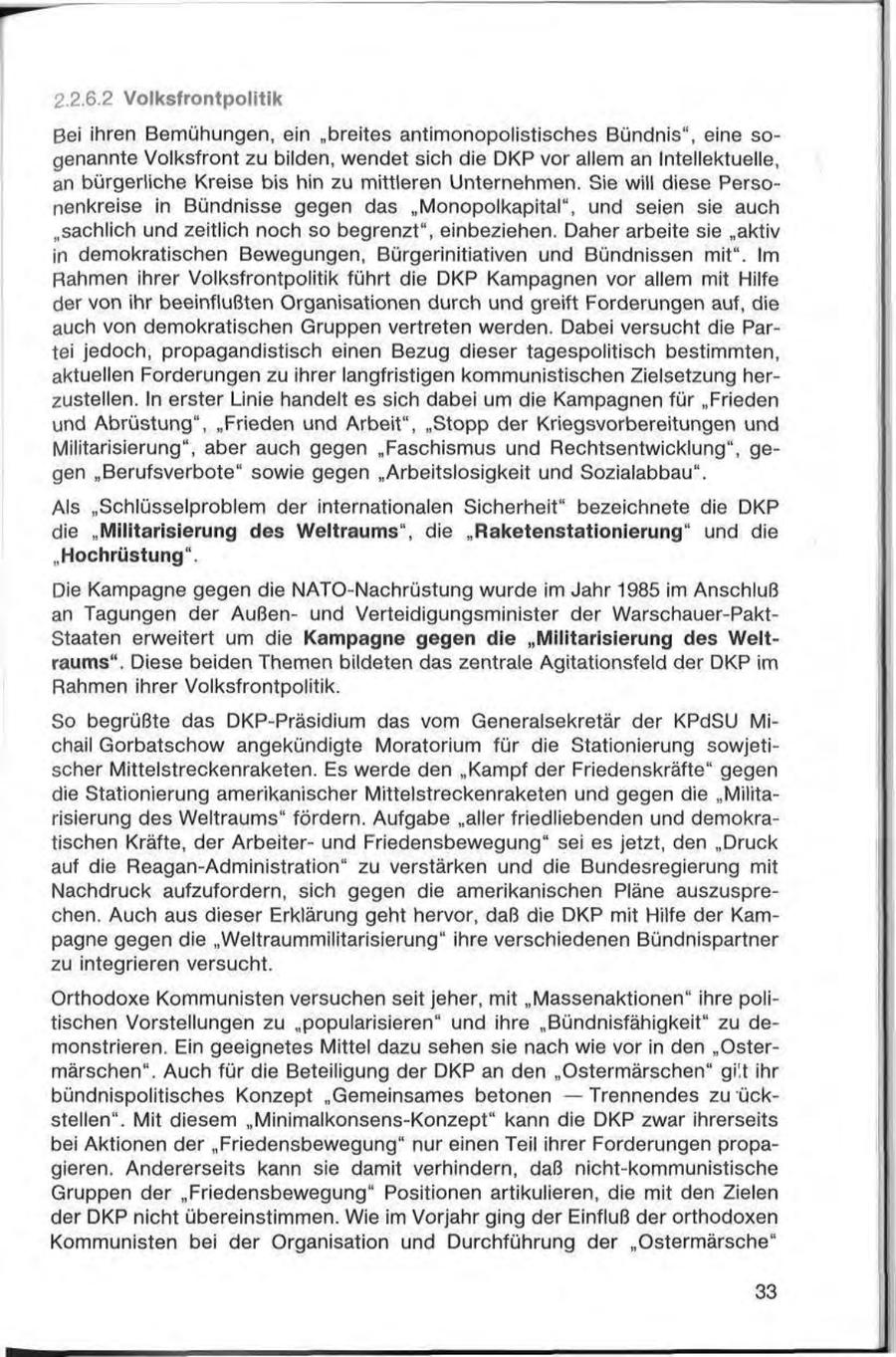
- kommunistischen Presse beteiligten sich etwa 700 "Betriebsräte, Gewerkschafter, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Mitarbeiter verschiedener Bürgerinitiativen, darunter auch Sozialdemokraten, Grüne und Parteilose
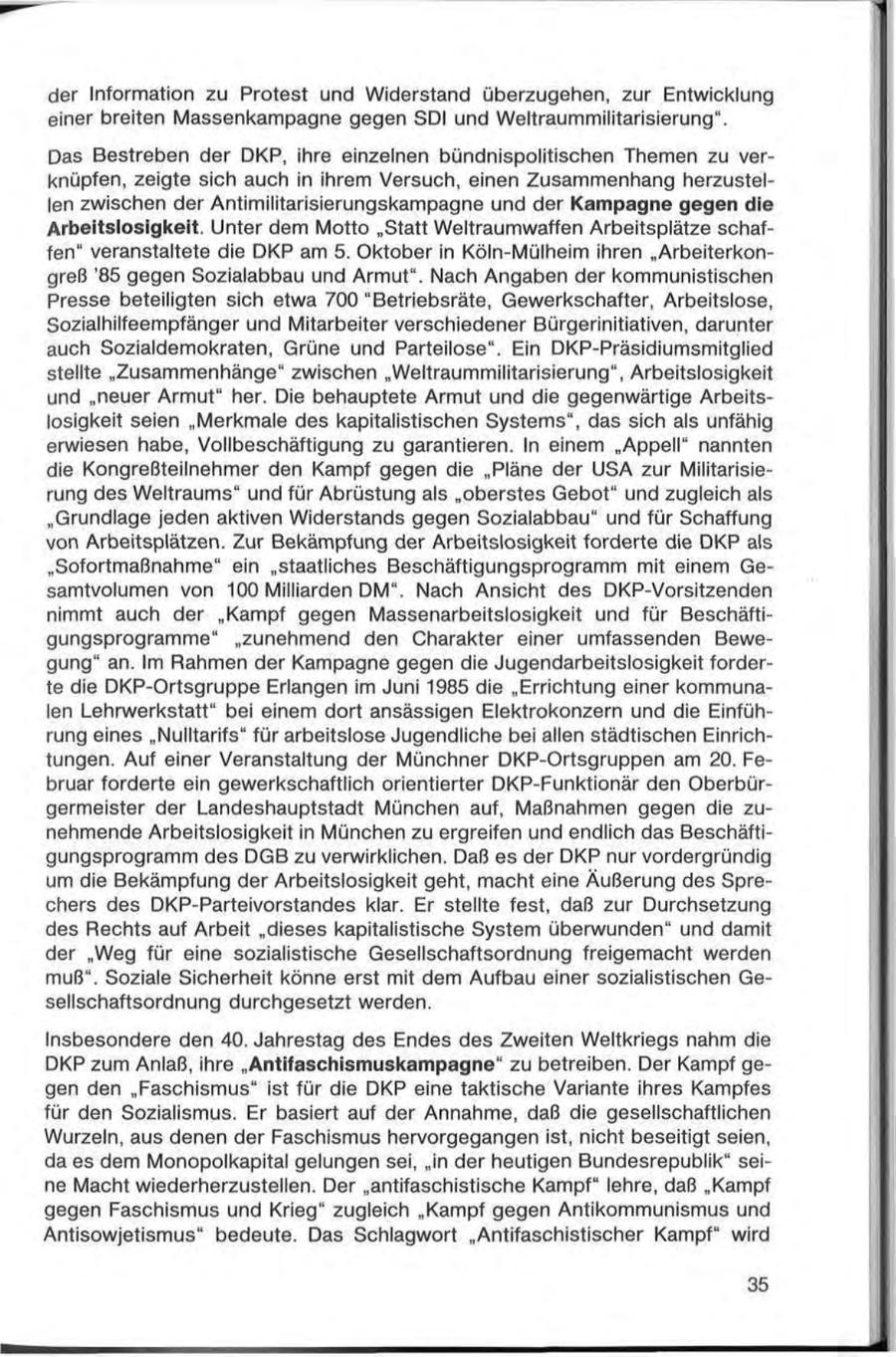
- Befreiung -- 8. Mai", "Die DKP -- eine demokratische Partei", "Mehr Kommunisten braucht das Land!". Aufsehen erregte die Veröffentlichung der Taschenbücher
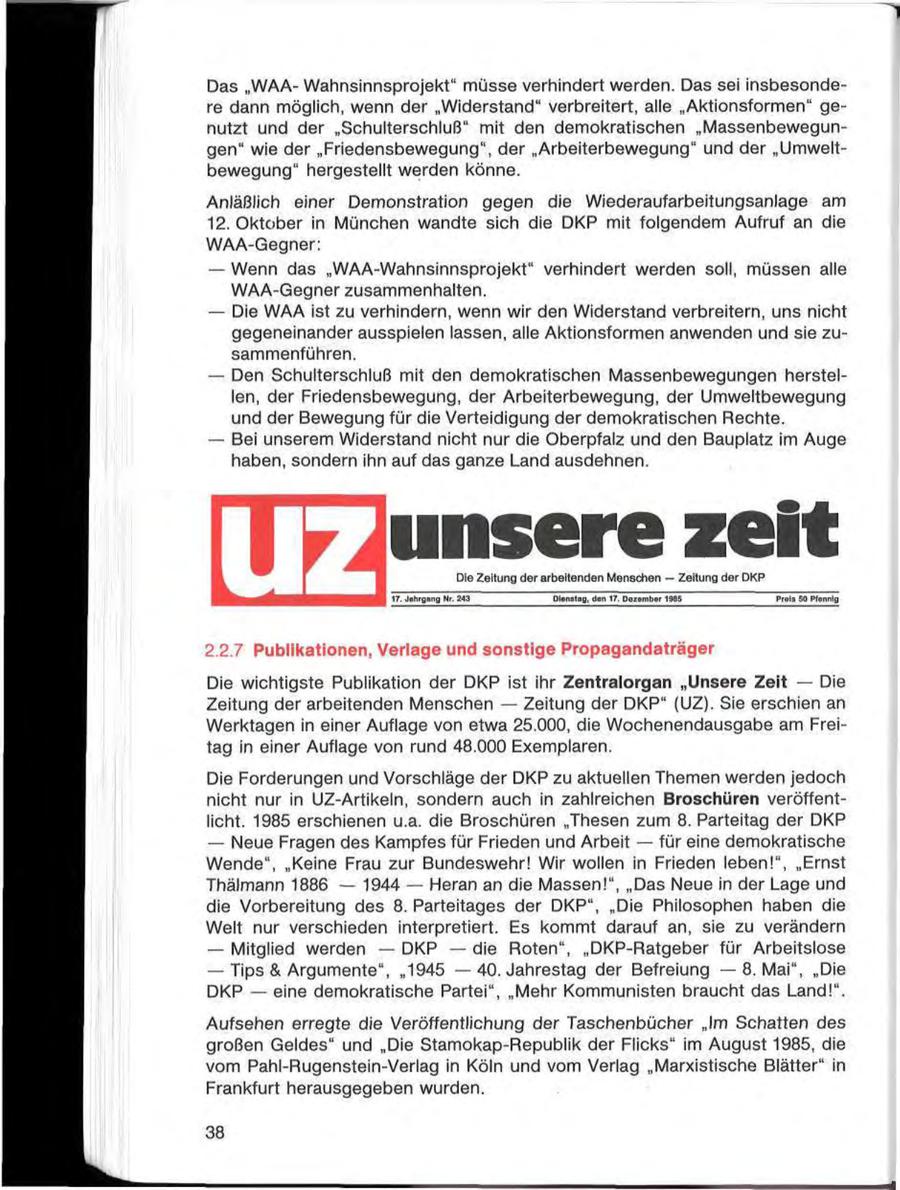
- vertiefen". "Unter den heutigen Bedingungen" werde von einem aktiven Kommunisten ein "hohes Maß an politischer Beweglichkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber allem
- weltanschaulichen Standpunkt" gefordert. Die DKP versteht sich als "einzige Partei der Bundesrepublik, die über eine einheitliche, wissenschaftliche Weltanschauung" verfüge
- Partei" sei davon abhängig, "wie die einzelnen Kommunisten und die Partei als Ganzes es verstehen, sich mit dieser Theorie vertraut
- Lenin vermittle die Fähigkeit, auch in "schwierigsten Situationen den kommunistischen Überzeugungen treu zu bleiben". Jedes Mitglied der DKP müsse sich
- befähigen, "offensiv und überzeugend" die "Weltanschauung und Politik" der Partei zu verbreiten. Ein wichtiger Bestandteil dieser "Arbeit" sei die "Arbeit
- Parteivorstandstagungen. Diesen Zielen sowie der Verwirklichung des Prinzips der kommunistischen Partei als einer "Gemeinschaft von Gleichgesinnten" dient die Intensivschulung
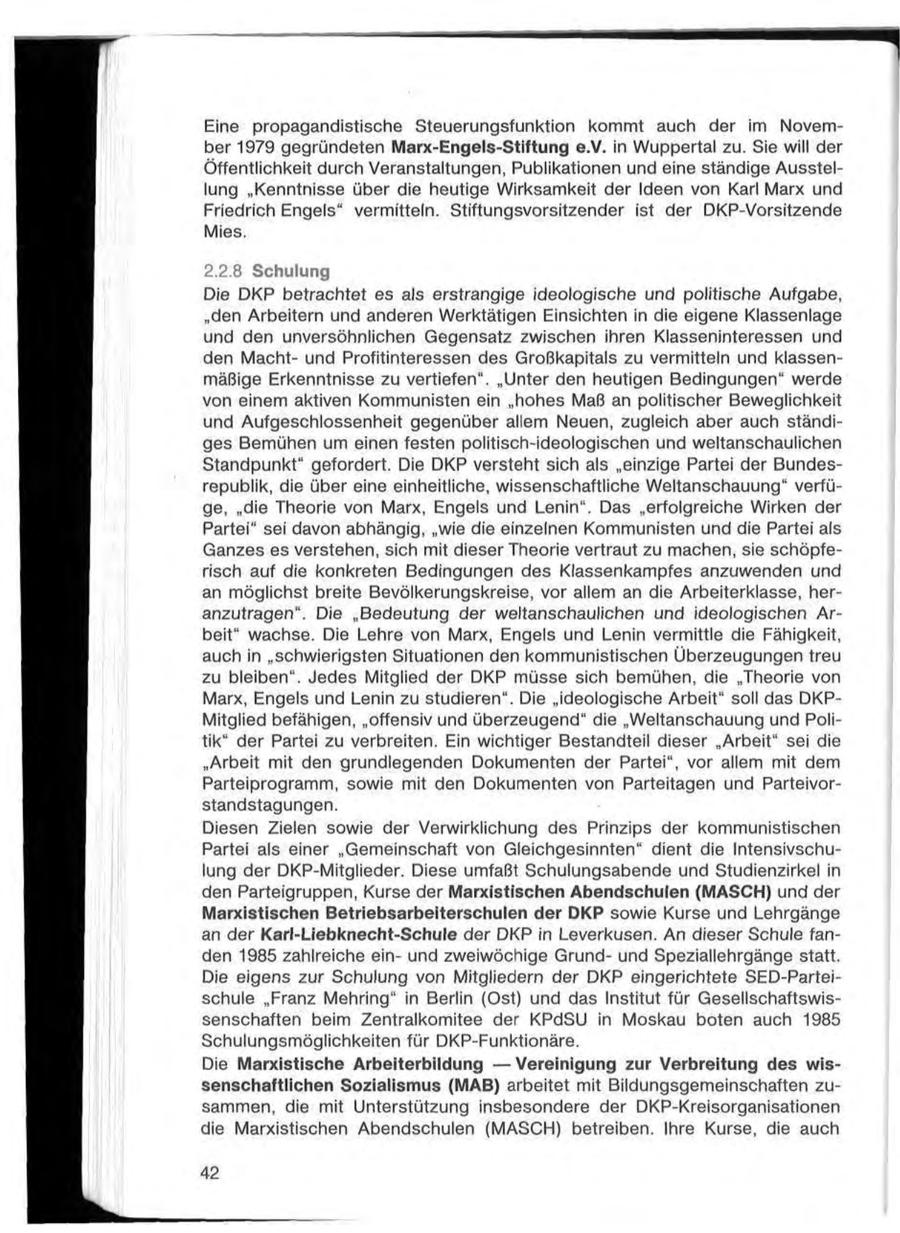
- Zukunft" in Betriebsarbeiteraussprachen, -beratungen und -Seminaren die Anwendung der kommunistischen Ideologie erklärt. Die Seminare dienen zugleich dazu, in Fortbildungsveranstaltungen
- Leiter des Wuppertaler "Marx-Engels-Zentrums". Der DKP-Parteivorstand setzte seine Veröffentlichungen zum Parteibildungsjahr 1984/85 fort. Im "Bildungsheft" für
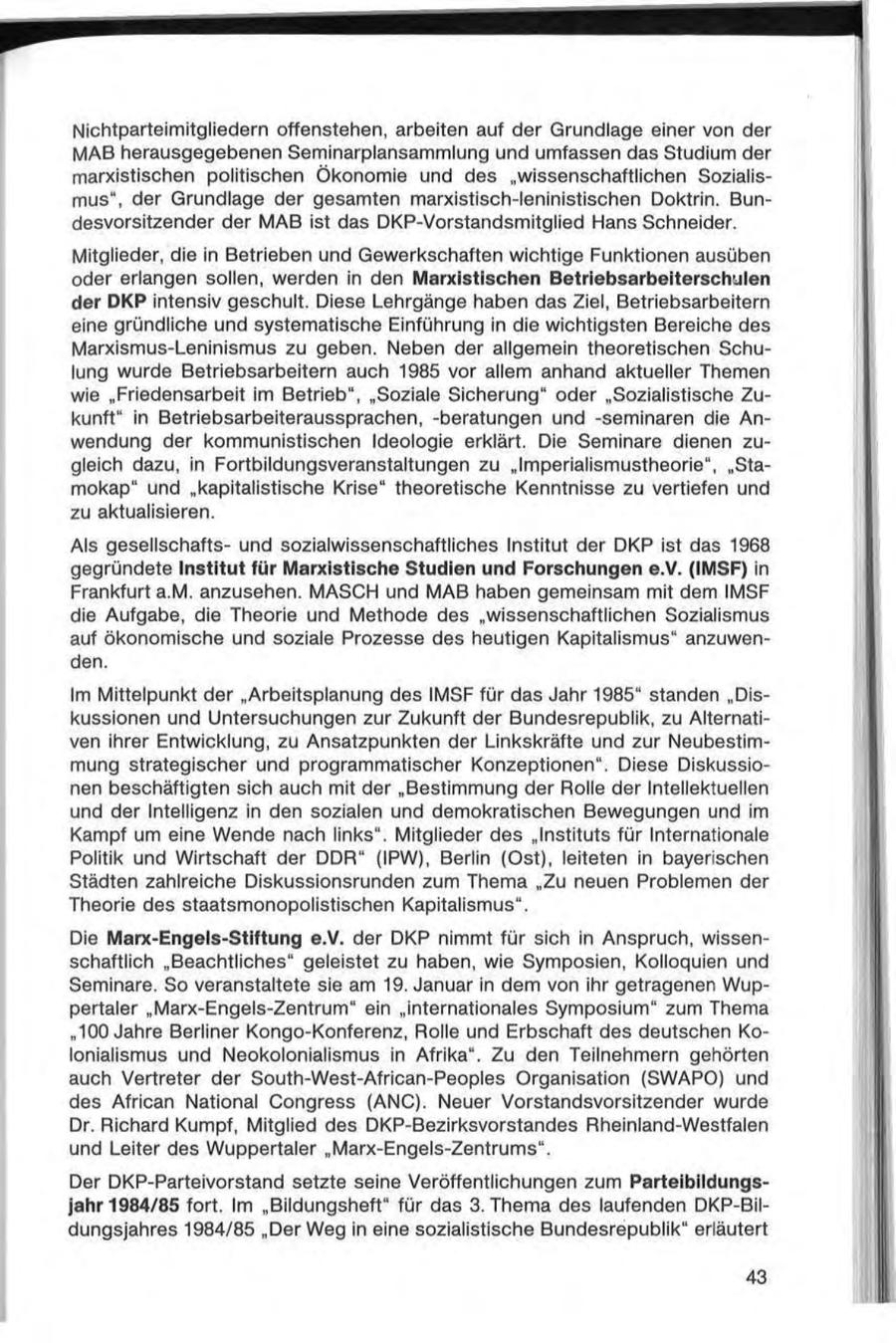
- Gerns sprach sich für eine "lebendige Diskussion" der vom Parteivorstand vorgelegten "Thesen" aus. Dazu gehöre auch, daß die DKP grundlegende
- Aussagen von "Bruderparteien", insbesondere aus dem überarbeiteten Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) in die Thesendiskussion einbeziehe. Die neuen